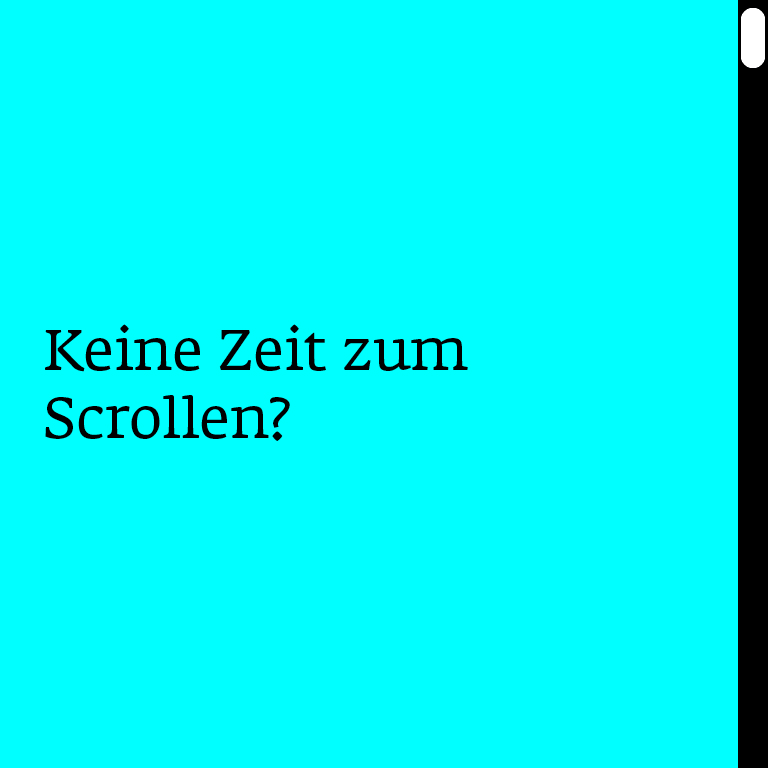Je höher der Preis, desto mehr Raum wird verschwendet
Nicht mehr freier Markt, sondern mehr gemeinnütziger Wohnungsbau wäre die Lösung der Zürcher Wohnungsnot.
Patrick Schellenbauer, Projektleiter der neoliberalen Denkfabrik Avenir Suisse, weiss genau, warum die Mieten steigen: höhere Löhne, verfehlte Markteingriffe und der gemeinnützige Wohnungsbau sind schuld. Die Zuwanderung akzentuiere nur ein weitgehend hausgemachtes Problem. Alteingesessene Mieter wohnten zu billig, was die Unterbelegung der Wohnungen fördere. Mieterinnen und Mieter im gemeinnützigen Wohnungsbau erhielten allein in der Stadt Zürich 350 Mio. Franken Subventionen pro Jahr. Avenir Suisse propagiert höhere Bodenpreise und freie Marktmieten als ökonomisches Signal für einen schonenderen Umgang mit dem Boden. Wer nicht mithalten kann, soll staatliches Wohngeld erhalten. Schauen wir uns die Avenir-Suisse-Thesen näher an.
Schellenbauer-These 1: Je höher Bodenpreise und Mieten, desto effizienter und sparsamer wird der Wohnraum genutzt. So will es die Theorie aus dem Elfenbeinturm der Marktgläubigen. Die Probe aufs Exempel führt dummerweise zum gegenteiligen Ergebnis. Laut Gebäudezählung verbrauchten 2000 die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher pro Kopf im Schnitt 39,9 Quadratmeter Wohnfläche. In den laut Avenir Suisse zu billigen Genossenschafts-Wohnungen waren es bloss 33,1 Quadratmeter, in den teuren Eigentumswohnungen dagegen 56,0 Quadratmeter – satte 70 Prozent mehr! In einer genossenschaftlichen 4-Zimmer-Wohnung leben im Schnitt 3,1 Personen, in einer 4-Zimmer-Eigentumswohnung bloss 2,1. Die Lösung des Rätsels ist einfach: gegen 90 Prozent der Genossenschaften kennen Belegungsvorschriften (in der Regel gilt Zimmerzahl = Zahl der Personen + 1). Dank dieser intelligenten Selbstregulierung kommen dort vor allem Haushalte mit Kindern zum Zug, die es sonst gegen kaufkräftige Einzelpersonen und kinderlose Doppelverdiener auf dem Wohnungsmarkt schwer haben. Das Fazit: je höher der Preis, desto grösser die Wohnraumverschwendung. Drastisch erleben wir das mit der massiven Zunahme teurer Business-Apartments und Zweitwohnungen. Zurzeit dürften in der Stadt Zürich zwischen 10 000 und 20 000 Wohnungen bloss zweitgenutzt sein und werden damit dem lokalen Wohnungsmarkt entzogen.
Schellenbauer-These 2: Mieterinnen und Mieter der 50 000 gemeinnützigen Stadtzürcher Wohnungen werden mit 350 Mio. Franken «subventioniert». Diesen exorbitanten Betrag errechnet er aus der Differenz zwischen Genossenschafts- und Marktmieten, frei nach dem Motto: wer beim Bodenpreis-Monopoly nicht mitzieht, verteilt marktverzerrende «Subventionen». Der Grund, warum Genossenschaften günstiger vermieten, ist simpel: sie setzen das Land zum ursprünglichen Wert ein und verrechnen ihren Mitgliedern nur die effektiven Zins-, Unterhalts- und Verwaltungskosten einschliesslich einer Vorfinanzierung für Erneuerungen. Als Selbsthilfegemeinschaft tun sie exakt dasselbe wie jeder private Hauseigentümer in seinem Eigenheim: sie decken nur die anfallenden Wohnkosten.
Schellenbauer-These 3: Wer beim Miet-Monopoly nicht mithalten kann, soll Wohngeld vom Staat erhalten. Meine Gegenfrage: Warum jetzt plötzlich doch Subventionen? Wo bleibt da die liberale Ordnungspolitik? Sollen ausgerechnet Spekulanten staatlich alimentiert werden?
Schellenbauer-These 4: Nur der Markt als Mass aller Dinge garantiert die gerechte Verteilung von Boden und Wohnraum. «Natürlich würde es gewisse Quartiere geben», so Schellenbauer im Tages-Anzeiger-Interview «in denen mehr Gutverdienende leben würden. Als Ökonom möchte ich Sie fragen: Was ist genau der Nutzen dieser Durchmischung für die Allgemeinheit?» Bestechend simpel formuliert Raumplaner Martin Geiger, wohin uns diese krude Marktlogik führt: «Auf den schlechten Standorten wohnen die Armen, auf den guten wohnen die Reichen und auf den besten residieren die Firmen.» Handfesten Anschauungsunterricht dazu bieten uns unsere Miteidgenossen in Schwyz, Zug und Nidwalden mit ihren Gettos für die Superreichen. Zu Ende gedacht, müssten wir in Zürich wegen ihrer geringen Kundenfrequenz und viel zu niedrigen Wertschöpfung schleunigst Gross- und Fraumünster abwracken und durch Banken, Konsumtempel oder Bordelle ersetzen.
Als Ungläubiger freue ich mich, wenn die Kirche weiterhin im Dort oder in der Stadt bleibt. Lebenswerte Städte sind Zentren der sozialen Vielfalt, keine Prärien des Homo Oeconomicus auf der Jagd nach der maximalen Bodenrente. Zum Glück gibt es dem Gemeinwohl verpflichtete Eigentümer, unter ihnen die Stadt Zürich, die wider alle ökonomische Avenir-Suisse-Logik ermöglichen, dass es in der City weiterhin Beizen und ab und zu einen Schuhmacher oder Schreiner gibt. Wir alle haben ein Recht auf Stadt. Das sollte uns gebeutelten Städterinnen und Städtern auch Patrick Schellenbauer von seinem Einfamilienhaus im grünen Hinterland von Winterthur aus zubilligen.
Niklaus Scherr, 67, ist pensionierter Geschäftsleiter des Zürcher Mieterinnen- und Mieterverbandes und Gemeinderat der Alternativen Liste.