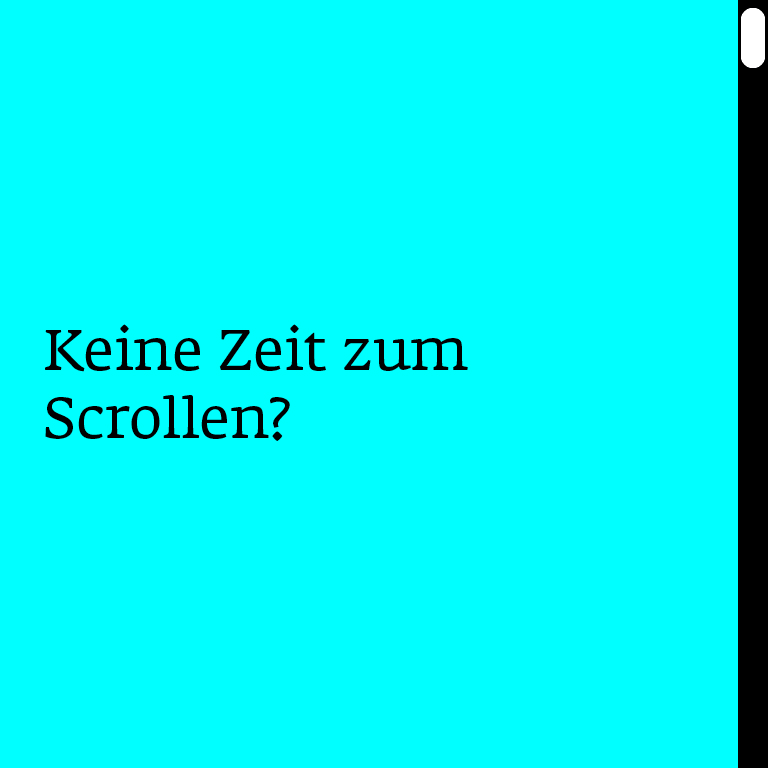Erstickungstendenz im Wettbewerbswesen
Der Architekt Emanuel Christ hat an der Vernissage der Ausstellung Bundesbauten in Zürich ein feuriges Plädoyer für mehr Offenheit im Architekturwettbewerb gehalten. Beschafft würde derzeit nur rekursrisikofrei ein Leistungsträger, überraschende Ideen würden systematisch ausgeschlossen, kritisierte der Architekt. Den Auszug aus seiner Rede lesen Sie hier.
Bundesbauten sind meistens öffentliche Bauten (ihre Fülle hier in der Ausstellung zu sehen, ist beeindruckend...). Sie sind für alle sichtbar, und werden oft von einem breiten Publikum mit grossem Interesse begutachtet. Bundesbauten sin Bauten, denen wir eine erhöhte Aufmerksamkeit entgegenbringen – als Betrachter und Benutzer. Und entsprechend hoch sind die Ansprüche, die an die öffentlichen Gebäude des Bundes gestellt werden. Bundesbauten stehen im Fokus. Das verpflichtet.
Das heisst, der Bund, in Form des BBL, muss nicht nur eine Nachfrage befriedigen und einen Zweck bedienen, sondern auch zeigen, was gutes Bauen ist. Dies entspricht seinem Auftrag. Mit anderen Worten: Bundesbauten stehen für exemplarisches Bauen. Das BBL setzt Standards, was die Planungs-und Baukultur in unserem Land angeht. Dabei denke ich natürlich zunächst an die Architektur selber. Neben dem Ergebnis zählt aber auch der Weg dorthin, ich spreche also auch vom Prozess. Wenn der Bund baut, dann geht es auch um vorbildliches Arbeiten. Und oftmals beginnt dieses Arbeiten an einem Projekt mit dem Architekturwettbewerb.
Der Architekturwettbewerb, so wie ich ihn verstehe, und so wie ich ihn auch mit dem BBL erlebt hatte, ist nicht nur ein Beschaffungsinstrument im Sinne des Submissionsgesetz sondern vor allem auch eine Innovationsplattform. Ein offenes Gefäss, das Raum für neue Ideen schafft. Wenn es nämlich die Ausschreibung eines Wettbewerbs zulässt, oder noch besser: wenn die Ausschreibung eines Wettbewerbs uns, die Architekten, die Jury und nicht zuletzt die Bauherren selber, dazu anregt und anstiftet, neue Vorstellungen zum Bauen, zur Stadt, zum Umgang mit dem Denkmal, ja zu unserer Gesellschaft zu entwickeln, dann (und erst dann) lohnt sich der Wettbewerb für alle Beteiligten und nicht nur für den Gewinner.
Aus Sicht des teilnehmenden Architekten: Wenn uns die Wettbewerbsaufgabe intellektuell herausgefordert hat, uns hat Neues denken und zeichnen lassen, dann hat sie uns weitergebracht. Und weil wir dabei etwas erlebt und entdeckt haben, hat der Wettbewerb uns auch noch Spass gemacht. Angesichts der hohen Kosten ist dies ein nicht unwesentlicher Nebenaspekt. Natürlich sind wir dann enttäuscht, wenn wir nicht gewinnen (und das ist bekanntlich meistens der Fall). Aber eben: Wir haben einen Beitrag geleistet und wir haben dabei etwas gelernt und uns und unsere Denk- und Arbeitsweise weiterentwickelt (in anderen Branchen heisst das Forschung und Entwicklung). Der Wettbewerb hat sich damit trotzdem gelohnt.
Leider geht die Tendenz im Wettbewerbswesen heute oft in die entgegengesetzte Richtung: Alles ist schon abgeklärt. Sämtliche entscheidenden Fragen sind schon beantwortet, bevor der Wettbewerb überhaupt erst anfängt. Etwas pointiert: Es wird rekursrisikofrei ein Leistungsträger beschafft, überraschende Ideen hingegen werden systematisch ausgeschlossen. Diese Haltung entspricht durchaus einem generellen Phänomen in unserer Gesellschaft: Es wird mit allen Mitteln sichergestellt, dass ja nicht irgendetwas Unerwartetes eintritt. Nur, genau so wird die lebendige Entwurfs- und Baukultur, auf die wir hier in der Schweiz zu Recht alle so stolz sind, regelrecht erstickt.
Dieser Erstickungstendenz müssen wir entgegentreten. Wir müssen ihr entgegentreten, indem wir uns für mehr Offenheit im Architekturwettbewerb einsetzen. Es ist besonders naheliegend, das hier an diesem Ort, an der ETH, zu sagen: Offenheit ist die Voraussetzung für jede Innovation. Dies gilt nicht nur für die technische und naturwissenschaftliche Forschung sondern eben auch für die Architektur. Der auf Innovation ausgerichtete Architekturwettbewerb braucht Bauherren, die offen sind für Neues. Er braucht Auslober, die sich überraschen lassen wollen. Und er braucht Jurymitglieder und Architekten, die das Risiko auf sich nehmen, eine unkonventionelle Lösung zu vertreten.
Diese Risikobereitschaft und Offenheit durften wir in unserer langen Zusammenarbeit mit dem BBL vom Wettbewerb im Jahr 2001/02 bis heute immer wieder erleben. Dafür möchte ich mich bei Ihnen allen, besonders bei Ihnen, Herr Winkler, herzlich bedanken. Und ich möchte mich auch dafür bedanken, dass ich heute gewissermassen als Fallbeispiel auftreten darf. Dies mag aus aktuellem Anlass sein, oder weil das Beispiel geografisch so nahe liegt, oder aber weil unsere Zusammenarbeit die vielleicht längste überhaupt ist, die das BBL je mit einem Architekten kontinuierlich an einem Projekt eingegangen war (Am Schluss werden es 20 Jahre sein! Neat ist an zweiter Stelle). Wie dem auch sei, ich freue mich und fühle mich geehrt, dass ich Ihnen im Folgenden einen kurzen Einblick in unser Projekt für die Sanierung und Erweiterung des SLM geben darf.
Das Landesmuseum ist eine Bundesbaute, die seit jeher eine ganz besondere, durchaus auch kritische Aufmerksamkeit geniesst. Sie erinnern sich: Heftige Kämpfe, erbittert dagegen und eben so vehement dafür. Prominente Köpfe haben die Klingen gekreuzt. Es wurde schnell klar, und das ist eben das Wesen eines öffentlichen Bauvorhabens. Es geht nicht nur um das Gebäude und die Architektur im engeren Sinne. Es geht um Grundsätzlicheres. Hier: Was ist unser Nationalmuseum? Was ist unser nationale Identität? Was soll da gemacht werden und was nicht? Es geht um das kulturelle Selbstverständnis einer ganzen Nation. Eine kulturelle und politische Debatte! Als Architekt mit seinem Projekt im Fokus dieser nicht immer ganz freundlichen Auseinandersetzung zu stehen, ist übrigens nicht immer ganz einfach.
Spätestens in dieser Zeit der politischen Diskussionen (2 Abstimmungen... ) wurde klar: Die Bauherrschaft, das BBL, die Vertreter des Landesmuseum und wir, die Planer und Architekten bilden eine Schicksalsgemeinschaft. Alle kämpfen darum, die Bürger, die Parlamentarier und die Verwaltung und nicht zuletzt auch immer wieder sich selber vom gemeinsamen Bauvorhaben zu überzeugen. Das schafft Verbundenheit und Vertrauen. Es trägt uns bis heute. Es ist ein Privileg, solche Erfahrungen zu machen. Auch dafür danke ich Ihnen.
Die Wanderausstellung «Bundesbauten» gewährt Einblicke in die vielfältige Bautätigkeit des Bundes – von 1848 bis heute. Die Schau fokussiert auf die spannenden Um- und Neubauten der letzten Jahre. Architekturhistorisches Rückgrat der Ausstellung ist der «Zeitstreifen», der die Entwicklung der Architektur der Bundesbauten von der Staatsgründung 1848 bis heute im Kontext der sich wandelnden Staatsaufgaben zeigt. Er erzählt eine kleine, aber feine Architekturgeschichte anhand der Bauten der offiziellen Schweiz.
«Bundesbauten» macht noch bis zum 4. Mai in der Haupthalle der ETH Zürich halt. Danach wandert sie weiter nach Chur, wo sie am 12. Mai an der HTW Chur neu eröffnet wird.