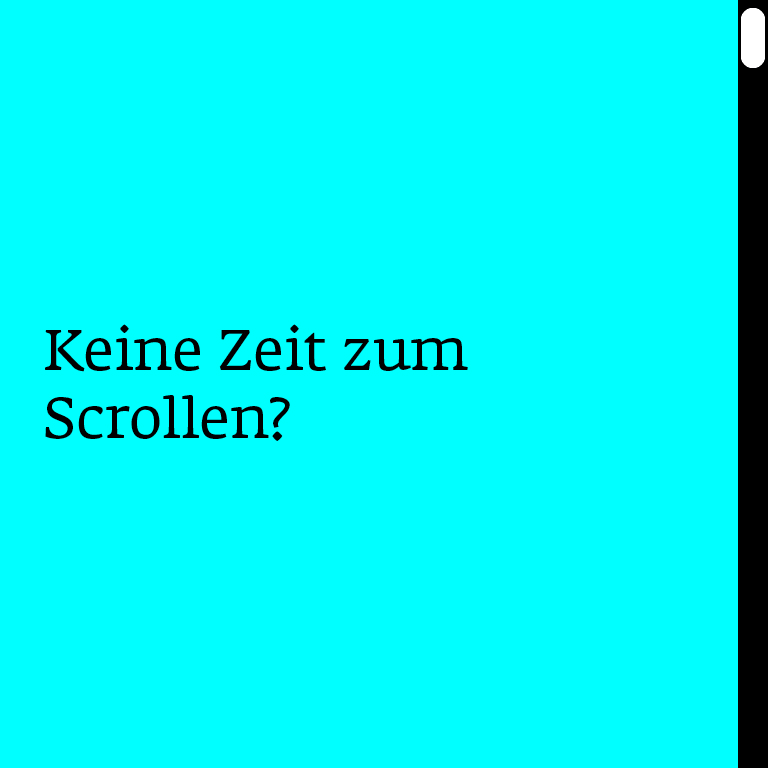Fürs ganze Leben
An der Eglistrasse hat die à Porta-Stiftung eine 90-jährige Siedlung ersetzt. Entstanden ist hochwertiger Raum für langjährige und neue Mieterinnen und jene Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen.
Ersatzneubau. Es gibt in der Planung wohl kaum einen Begriff, der so schnell vom Zauber- zum Schimpfwort wurde. Vor kaum zehn Jahren galt der Ersatz von verwohnten Altbauten als Königsweg, um auf einem Grundstück mehr und besseren Wohnraum zu schaffen. Heute assoziiert man das gleiche Vorgehen primär mit der Zerstörung von günstigem Wohnraum und mit viel grauer Energie. Erhalten, sanieren und weiterbauen ist heute die Devise. Doch wie so oft ist es komplizierter, als man denkt. Dies zeigt die Siedlung Eglistrasse. Stephan à Porta errichtete sie 1931. Verputztes Mauerwerk, Kunststeinfenstereinfassungen, Klappläden, eingezogene Balkone: eine solide Sache, so schien es. Ideal also, um mit einer sanften Sanierung günstigen Wohnraum zu erhalten. Oder doch nicht?
Der alte Makel der à Porta-Häuser
Ken Architekten prüften, wie die Siedlung zu sanieren wäre, genauso wie sie zuvor auch die gegenüberliegenden Hauszeilen an der Eichbühlstrasse für einen neuen Lebenszyklus fit gemacht hatten. Doch schnell zeigte sich, dass die scheinbar gesunden Häuser an zahlreichen Krankheiten litten, deren Heilung mit zu hohen Mieten zu Buche geschlagen hätte. Weil zur Bauzeit das Material teuer und die Arbeit billig war, und weil à Porta nicht nur wohltätige, sondern durchaus auch finanzielle Überlegungen anstellte, setzte er beim Bau die unterschiedlichsten Materialien ein – egal, wie sinnvoll oder dauerhaft sie waren, günstig mussten sie sein. Die Schallisolation war so schlecht, dass man in der Wohnung dem Fernsehprogramm des Nachbarn folgen konnte, selbst wenn das Gerät auf Zimmerlautstärke eingestellt war. Wegen des Verkehrslärms hätten Wohnungen zusammengelegt werden müssen, um den Vorschriften zu genügen. Von Erdbebensicherheit konnte zudem kaum die Rede sein. Ein Makel, der etlichen Bauten von Stephan à Porta anhaftet, zeigte sich in der grossen Siedlung exemplarisch: Anstelle einer Vielfalt von Wohnungen für unterschiedliche Bedürfnisse gab es ausschliesslich Zwei- und Dreizimmerwohnungen sowie ein paar kleine Vierzimmerwohnungen.
Nun stehen anstelle der alten, von Satteldächern gedeckten viergeschossigen Gebäude zwei neue u-förmige Bauten mit zurückgesetztem Attikageschoss und Flachdach da. Balkone und Erker rhythmisieren die Fassaden, kaum wahrnehmbare Absätze nehmen den Terrainverlauf auf. Von der Eglistrasse führt eine Stichstrasse in die Tiefe des Grundstücks. In langen Verhandlungen ist es gelungen, das Strassenstück der Stadt abzukaufen und zu einem platzartigen öffentlichen Raum umzugestalten. «Die Egligasse ist das Rückgrat, ja das Entree der Siedlung», sagt Martin Schwager von Ken Architekten. Hier trifft sich die Bewohnerschaft, denn alle Wege zu den Wohnungen führen hier durch. Auch die Küchen der angrenzenden Wohnungen blicken auf diesen Ort, der sich schnell zum gemeinschaftlichen Brennpunkt entwickelt hat. Zwei Durchgänge führen in die beiden Höfe, die Studio Vulkan parkartig gestaltet hat. Noch sind die Bäume klein, doch der Platz zum Wachsen ihrer Wurzeln ist unbeschränkt: Die Überbauung hat keine Tiefgarage; die nötigen Parkplätze konnten in einer benachbarten Garage untergebracht werden.
«Quartiererhaltungszone» heisst es auf dem Zonenplan. Was die weitgehende Übernahme der Höhe der Altbauten bei einer Gebäudetiefe von 12 Metern bedeutete. Das Attikageschoss darf auf einem Drittel der Länge bis an die vordere Fassadenflucht stossen, Erker und Balkone dürfen ebenfalls auf einem Drittel darüber hinausragen. Auf der Hofseite, wo à Porta seinerzeit das Terrain abgraben liess, um Garagen im Untergeschoss unterzubringen, galt dieses abgegrabene nun als gewachsenes Terrain. Dies zeigt sich heute in der bewegten Landschaft der neu gestalteten Höfe. Ein ziemlich enges Korsett also, in dem sich die Architekten bewegen mussten. «Eigentlich sollte man an dieser Lage doch verdichten», sagt Martin Schwager. Der Blick auf die Neubauten gibt ihm recht: Ein zusätzliches Vollgeschoss würde das Quartier problemlos ertragen, und gegen die viel befahrene Hohlstrasse am Gleisfeld wäre ein noch höheres Gebäude denkbar. Dass dies hier nicht möglich war, ist der Daseinsgrund der Quartiererhaltungszone: Brüche im Stadtgefüge zu verhindern. Doch wäre ein solcher Bruch hier, im äusseren Aussersihlquartier, nicht eher ein Entwicklungssprung?
Man merkt es Martin Schwager an, dass er gerne höher, vielleicht auch anders gebaut hätte. Doch er habe sich mit dem «reaktionären Städtebau» versöhnt. Die ersten Entwürfe zeigten dann historisierende Grundrisse mit grossen Wohndielen und auch einem eher historisierenden architektonischen Ausdruck. Doch dann liessen die Architekten solche Bilder hinter sich. «Wir leben ja nicht im späten 19., sondern im 21. Jahrhundert», meint Schwager. Nun geben das Mauerwerk aus Kalksandstein und Balkonbrüstungen aus farblos eloxiertem Aluminiumtrapezblech den Bauten einen zeitgemässen Ausdruck.
Ein breites Spektrum an Möglichkeiten
Die neue Überbauung zählt 148 Mietwohnungen mit 53 unterschiedlichen Grundrissen, die auf 15 Grundtypen basieren. 2,03 beträgt die Ausnützungsziffer, also fast 0,5 mehr als bei den Altbauten, was Wohnraum für rund zusätzliche 100 Personen bedeutet. Der Neubau ermöglichte aber nicht nur einen vielfältigen Wohnungsmix, sondern auch unterschiedliche Wohnformen. Damit kann die à Porta-Stiftung den Kern ihres Zwecks erfüllen: sozial tätig zu sein. In den beiden Höfen steht je ein zweigeschossiger, sternförmiger Bau mit vier Wohngemeinschaften des Vereins Jugendwohnnetz. Zehn Wohnungen wurden zusammen mit dem Verein Hindernisfreies Wohnen für die Bedürfnisse der Menschen im Rollstuhl massgeschneidert.
Im Eckgebäude an der Hohlstrasse / Eglistrasse, gekennzeichnet durch eine Rotunde an der Ecke, ist das Palliativzentrum Lighthouse eingemietet. Dass die Stiftung Lighthouse in der Überbauung Platz finden würde, war bereits früh klar. So konnten das Raumprogramm und die Gestaltung gemeinsam entwickelt werden. Gleich neben dem Ort, wo Menschen ihr Leben in einem würdigen, betreuten Rahmen abschliessen können, hat die Stadt Zürich einen Kindergarten eingerichtet – so spannt die Überbauung Eglistrasse den ganzen Lebensbogen auf.
Trotz Neubau ist die Schaffung von günstigem Wohnraum ein zentrales Anliegen der Stiftung. In erster Linie erreicht man dies mit knappen Flächen: Ein Koch- und Essraum schlägt mit knapp 22 Quadratmetern zu Buche, der Wohnraum mit knapp 16, die Schlafzimmer sind 13 bis 14 Quadratmeter gross. Dennoch wirken die Wohnungen grosszügig. Dies liegt zum einen an der Raumhöhe von 2,62 Metern, aber auch an der geschickten Grundrissdisposition: Die Architekten rückten die raumhohen Zimmertüren an die Fassaden, sodass sich der Raum seitlich öffnet und grosszügiger wird. Zur Grosszügigkeit tragen auch die froh stimmenden Materialien und Farben bei. Am Boden liegt gelblicher Jurakalk, aus dem die übrigen Farben herausdestilliert wurden: das Hellblau der Einbauküchen, das Ziegelrot der Zimmertüren und die Auberginenfarbe der Wohnungstüren. Die Badezimmerwände sind mit fliederfarbenem Feinsteinzeug belegt; geschickt platzierte Spiegel ergänzen den Spiegelschrank und vergrössern das Badezimmer so optisch. Dank intensiver Verhandlungen mit den diversen Nutzergruppen gelang es den Architekten, ein einheitliches Material- und Farbkonzept zu erarbeiten. So liegt auch in den allgemeinen Räumen des Lighthouse der gelbe Jurakalkstein am Boden, und an den Türen und Einbaumöbeln finden sich die gleichen Materialien und Farben wie in den Wohnungen. Und trotz beschränkter Mittel entdeckt man auf einem Rundgang zahlreiche Details, die als feine Akzente zur gestalterischen Qualität beitragen. So heben in den Liften runde Spiegel die Kabine über den Standard hinaus, und in den Treppenhäusern nehmen runde Einlagen die Leuchten auf. Kalottenförmige Einlagen in der Betondecke über der Lighthouse-Dachterrasse bieten liegenden Patientinnen und Patienten eine Abwechslung.
Qualität ist auf Dauer günstiger
Doch wie passt die Prämisse des günstigen Wohnungsbaus zum Natursteinboden? Entscheidend ist die Zeitachse, die bei der Stiftung à Porta deutlich länger ist als bei einer renditegetriebenen Bauherrschaft: Da die Stiftungsurkunde den Liegenschaftsverkauf verhindert, kann die Stiftung über einen Zeitraum von 100 Jahren planen und kalkulieren. Stellt man bei einem Parkettboden den Unterhalt in Rechnung – Abschleifen durchschnittlich alle 15 Jahre –, relativiert sich das Bild: Nach 31 Jahren ist der Mehrpreis des Natursteins amortisiert. «Über 100 Jahre betrachtet, machen die Investitionskosten rund 20 Prozent aus. 80 Prozent fallen im Betrieb, beim Unterhalt und der Erneuerung an», so Martin Schwager. Wenn der Statiker für die Tragstruktur von 100 Jahren Lebensdauer ausgeht, soll auch die Fassade mindestens so lange halten. Also sind die Wände bei der Siedlung Eglistrasse aus Kalksandstein und die Fassaden zweischalig ausgebildet. Mit Blick auf das äusserst dauerhafte Sichtmauerwerk älterer Bauten in der Stadt blieb der Kalksandstein unverputzt. Dafür verleihen ihm Rillen eine Struktur, die ein feines Spiel von Licht und Schatten erzeugt – «gratis», sagt Martin Schwager und schmunzelt. Und wenn die Sanitärleitungen eine Lebensdauer von 50 Jahren haben, soll auch die Küche so lange halten, erläutert Schwager die Wahl der Metallküchen. Auch die Aluminiumfenster haben sich in den Berechnungen über längere Zeit als günstiger entpuppt als andere Konstruktionsarten. «Die Gläser lassen sich ja dereinst durch bessere ersetzen», so Schwager.
Während des langen und intensiven Planungsprozesses entwickelte sich ein Vertrauensverhältnis zwischen der Bauherrschaft und den Architekten. Das motivierte die Stiftung dazu, Ken Architekten auch mit dem Umbau für das Theater Sogar und das Jazzhaus zu betrauen. Als Armin Isler 2015 die Geschäftsführung der Stiftung übernahm, stand er vor der Aufgabe, rund 400 Wohnungen in die Zukunft zu führen. Ken Architekten analysierten daraufhin das Quartier, sanierten die Zeilen an der Eichbühlstrasse und beschäftigten sich schliesslich mit der Eglistrasse. Kein Wettbewerb also? Nein, bestätigt Schwager die Tatsache, die er oft als Vorwurf hört. Auch sein Büro hat schon etliche Aufträge über Wettbewerbe gewonnen, doch in Zürich würden sie heute nicht mehr teilnehmen – zu dick und zu determiniert seien die Programme. Wichtig sei es doch, dass etwas Gutes geschaffen werde. Dafür brauche man die nötige Zeit im Planungsprozess und eine gute Bauherrschaft. «Es ist ein Geschenk, wenn man sich als Architekt in unterschiedliche Welten begeben kann», sagt Martin Schwager und freut sich über seinen Beruf.
Siedlung Eglistrasse, 2023
Eglistrasse 1–11, 19–29; Eichbühlstrasse 32–36; Hohlstrasse 315, 317, Zürich
Bauherrschaft: Dr. Stephan à Porta-Stiftung, Zürich
Architektur, Baumanagement, Bauleitung: Ken Architekten, Zürich
Landschaftsarchitektur: Studio Vulkan, Zürich
Kosten (BKP 1–5): Fr. 77 Mio.
Mietzinsbeispiele
2,5-Zimmer-Wohnung, 47 bis 61 m2, Fr. 900.— bis 1510.— (exkl. Fr. 120.— NK)
4,5-Zimmer-Wohnung, 84 bis 105 m2, Fr. 1930.— bis 2420.— (exkl. Fr. 135.— NK)
Themenheft
Dieser Text stammt aus dem Themenheft «Ein grosses Erbe». Es entstand in Zusammenarbeit mit der Dr. Stephan à Porta-Stiftung.