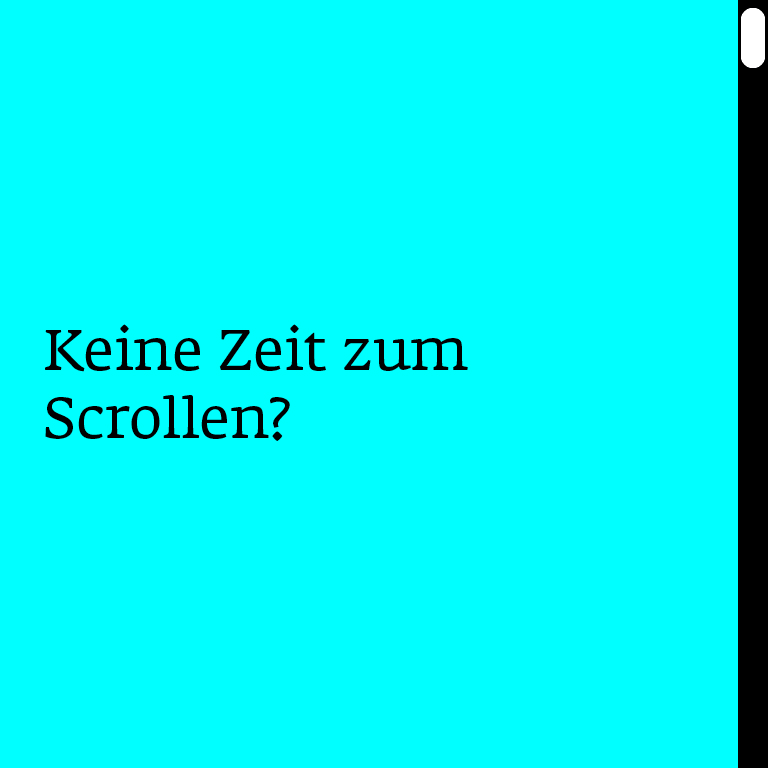Platznot im Untergrund
Je dichter die Bebauung über dem Boden, desto enger wird sie auch im Untergrund. Vor allem in den Städten fehlt es unterirdisch an Platz. Koordination ist das Gebot der Stunde.
Gross angelegte Strassenbaustelle im Zürcher Universitätsquartier. Die Tramschienen sind frisch verlegt, die neu gestaltete Haltestelle ist in Betrieb. In der Strassenmitte, dort, wo vor dem Umbau das Tramtrassee war, klaffte lange ein Graben. Er gab den Blick frei auf Rohre und An schlüsse, die normalerweise versteckt unter dem Asphalt liegen. «Hier verläuft eine der Hauptwasserleitungen der Stadt», erklärt Christian Meier, Projektleiter beim Tiefbauamt der Stadt Zürich bei der Besichtigung. Wegen der neuen Linienführung des Trams musste sie in die Strassenmitte verlegt werden. Wasserleitungen dürfen aus Sicherheits und Unterhaltsgründen nicht unter den Gleisen liegen. Die alten, spröde gewordenen Wasserrohre hat man durch Material aus duktilem Guss ersetzt. Diese sollten nun wieder einige Jahrzehnte halten.
Ein Novum ist die ins unterirdische Leitungslabyrinth integrierte Messanlage, die laufend die Wasserqualität prüft und die Resultate an die Leitzentrale der Wasserversorgung übermittelt. Eine solche Messanlage einzubauen, wünschte man seitens der Industriellen Betriebe der Stadt Zürich erst vor wenigen Monaten. Solche Aufgaben würden zum Alltag eines Projektleiters gehören, sagt Christian Meier: «Laufend treten neue Bedürfnisse auf, die Platz im Boden beanspruchen. Die Koordination der Werkleitungen ist bei uns Dauerthema. Hat es Platz? Was kostet es? Wie kombinieren wir die Ansprüche? Wie können wir die Versorgung trotz Baustellen sicherstellen? Und wie leiten wir den Verkehr auf der Oberfläche?»

In der Stadt Zürich sei der Untergrund bereits ausgelastet, «doch die Platznot wird sich noch verschärfen», bestätigt Christoph Braun, Leiter der Baukoordination der Stadt Zürich. Die dem Tiefbauamt angegliederte Amtsstelle entstand 1992, um den drohenden Leitungswildwuchs im öffentlichen Grund abzuwenden und die Bau und Unter haltsarbeiten der verschiedenen Beteiligten abzustim men. Dazu gehören die Industriellen Betriebe der Stadt Zürich, zuständig für die Wasser und Stromversorgung und für die Verkehrsbetriebe, das Tiefbau und Entsor gungsdepartement mit Abwasserentsorgung, Fernwärme und Grün Stadt Zürich sowie zahlreiche weitere städti sche und private Anbieter etwa für die Gasversorgung und den Telekombereich.
Basierend auf einem Regelquerschnitt legt die Stadt Zürich seither fest, welche Werkleitungen für die öffentliche Infrastruktur wo und in welcher Tiefe verlegt werden sollten. Als Grundsatz gilt: Strom und Telekomleitungen kommen unter das Trottoir, die Wasserversorgung und die Kanalisation unter die Strasse. Hinzu kommen weitere Versorgungsleitungen, namentlich für Gas und Fernwär me. «Jeder Anbieter speist die Informationen über Lage und Verlauf seiner Werkleitungen sowie Unterhalts oder Bauprojekte in unseren GIS-Datenserver ein. So haben wir einen Überblick über das gesamte Netzwerk und die aktuelle Situation», sagt Christoph Braun. Zurzeit betreut er mit seinem Team rund 500 Projekte in unterschiedlichen Planungs und Baustadien. Sie zu bündeln und zu koordinieren, ist eine Herkulesaufgabe. Angesichts neuer Platzansprüche, vorab für die Energieversorgung und die Kanalisation, wird es zudem immer schwieriger, effiziente und langfristige Lösungen zu finden.

Von der Kloakenreform zum Glasfasernetz
Angefangen hat die Erschliessung des Zürcher Untergrunds für die städtische Infrastruktur 1867 mit der Kloakenreform: Wegen Cholera und Typhusepidemien beschlossen die Stimmbürger, die offen geführten Abwäs ser zu überdecken und die Kanalisation in Rohre zu verle gen. Kurz darauf wurde die zentrale Wasserversorgung mit unterirdischen Wasserleitungen eingeführt und schnell ausgebaut. Im Lauf der Jahre drangen weitere Infrastrukturen in den Untergrund: Stromversorgung und Telekommunikation, ursprünglich über Freileitungen in die Häuser geführt, verlaufen heute im Stadtgebiet ausnahmslos unter dem Boden. Schweizweit steht die Versenkung von Höchstspannungsleitungen zur Diskussion. Teuer zwar und aufwendiger in Unterhalt und Reparaturen, doch weil in den Boden versenkte Bauwerke weniger Widerstand und Einsprachen provozieren, dürfte der Trend zur Untergrundlösung anhalten.
Gleichzeitig heisst das: Unter dem Boden wird es in dicht besiedelten Gebieten immer enger. Auf dem Gebiet der 90 Quadratkilometer grossen Stadt Zürich liegen heute knapp 5000 Kilometer Stromkabel, 1500 Kilometer Wasserleitungen und 1000 Kilometer Abwasserkanäle, teils von beträchtlichem Durchmesser. Dazu die Leitungen für die Telekommunikation und den schnellen Datentransport. Von der Steuerung der Verkehrsampeln über die Echtzeitinformationen an Bus und Tramhaltestellen bis zur Datenversorgung von Banken, Versicherungen oder Privathaushalten – alles verläuft unterirdisch. Bis 2019 werden in der Stadt Zürich zudem neunzig Prozent aller Gebäude an das Glasfasernetz angeschlossen sein.
Kaum Platz reserviert für Fernwärme
Der Grossteil der unterirdischen Infrastrukturbauten liegt zwischen vierzig Zentimetern und zehn Metern unter der Oberfläche. Kanalisationsrohre findet man zu weilen in beträchtlicher Tiefe, damit das nötige Gefälle er reicht werden kann. Problematisch wird dies dann, wenn die Kanalisation erneuert oder erweitert werden muss – eine Folge der baulichen Verdichtung: Das Regenwasser kann wegen der zunehmenden Bodenversiegelung nicht mehr versickern, Klimaveränderungen bringen mehr Starkregen mit sich, und die Menge des Abwassers steigt mit dem Bevölkerungswachstum.
Die zweite grosse Aufgabe für die Untergrundplaner der Stadt Zürich ist der Ausbau von Fernwärme- und Fernkältenetzen. «Aus umweltpolitischer Sicht ist das sinnvoll und nachhaltig», sagt Christoph Braun. «Aber wir haben es teils mit sehr grossen Durchmessern zu tun, und häufig braucht es zwei Leitungen für den Vor und den Rücklauf. Das kostet weiteren Platz und kann zu Konflikten mit den Hausanschlussleitungen führen.» Oft fehlt der Platz, und für diese zusätzlichen Fernwärmeleitungen sind zu wenig Freiräume reserviert. Weil sie teils heisses Wasser transportieren und trotz Isolation zu einer messbaren Erwärmung des Erdreichs führen, dürfen sie aus hygienischen Gründen nicht zu nah neben den Frischwasserleitungen geführt werden.
Wegen solcher Vorschriften bohrt die Stadt für die Fernwärmeverbindung zwischen der Kehrichtverbren nungsanlage Hagenholz und der Stadtmitte in Tiefen von zwanzig bis neunzig Metern bergmännisch einen Tunnel von rund drei Metern Durchmesser. «Der Bau die ses Fernwärmestollens ist etwa so kompliziert wie jener der SBB Durchmesserlinie», vergleicht Christian Meier. Vom Hauptstollen müssen später weitere Fernwärmeleitungen durch die Strassen in die Quartiere und zu den Liegenschaften gezogen werden.
Für Erdwärmesonden, gegen Wärmeklau
Was in Häusern einst ein Kellergeschoss war, wo Kartoffeln, Kohle und Wein lagerten, ist längst zur Tiefgarage erweitert – bisweilen auf zwei, drei oder gar mehr Unter geschossen. Auch alle Hausanschlüsse für Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Fernwärme und Datentransport werden unter dem Boden in die Gebäude geführt. Im Zeichen der Energiewende werden seit 2004 immer mehr Erdsonden bis in rund 200 Metern Tiefe gebohrt, um Erdwärme zum Heizen zu gewinnen. Obschon erst vier Prozent der benötigten Raumwärme in der Schweiz geothermisch gewonnen werden, spricht Roland Wagner vom Zürcher Amt für Städtebau von einem Boom, den er begrüsse, denn diese Technologie berge Reserven, die längst nicht ausgeschöpft seien. Aber weder Gesetzgebung noch Praxis hätten der Entwicklung bisher genügend Rechnung getragen. So war im Kanton Zürich der Gewässerschutz das einzige Bewilligungskriterium für die Genehmigung einer Erdwärmesonde. Gerade in der dicht bebauten Stadt gilt es aber, weitere Faktoren zu berücksichtigen, sonst droht bei zu dicht gesetzten Sonden ein ‹Wärmeklau›.
Auch andere Nutzungskonflikte lauern: Bei der Planung der Durchmesserlinie wurden zwei Erdwärmesondenanlagen direkt über dem geplanten Tunnelquerschnitt entdeckt. Um die Bedingungen für Wärmepumpen gesamtschweizerisch zu vereinheitlichen und als probates Planungsinstrument zu etablieren, überarbeitet der SIA die entsprechenden Normen. Auf Qualität und Nachhaltigkeit zu achten, ist unerlässlich: «Denn sind die Sonden einmal im Boden drin, kann man sie nicht mehr zurück bauen», gibt Roland Wagner zu bedenken.
Vertikal gestapeltes Eigentum
Der zunehmende Druck, den Raum unter der Erdober fläche zu nutzen, ruft nach neuen Regelungen. In der Schweiz existiert bisher kein Bundesgesetz für den Untergrund. Gemäss herrschender Lehre erstreckt sich das Grundeigentum so weit in die Tiefe, wie es genutzt wird. Was darunter liegt, gilt als öffentlich und untersteht dem jeweiligen kantonalen Recht. Doch diese Auffassung gerät unter Druck, weil in den obersten fünfzig Metern des Untergrunds die Platznot immer grösser wird. So schreibt etwa Michael Fuchs in seiner Dissertation von 2017: «Einen neuen Eigentumsbegriff einzuführen, der dreidimensionales Eigentum vertikal gestapelt überein ander zulässt, brächte mehr Flexibilität, und man könnte auf komplizierte Rechtskonstrukte verzichten.» Einige Kantone haben zeitgemässe Gesetze über die Nutzung des tiefen Untergrunds erlassen, die vorab Res sourcen und Räume 300 Meter und tiefer unter der Erdoberfläche betreffen. Damit umfassen diese Gesetze auch Nut zungsansprüche im Bereich der Geothermie – wichtig hinsichtlich der Energiestrategie 2050 des Bundes. Im Kanton Zürich wartet in zwei Gebieten ein weiterer, eher ungern gesehener Interessent: Ab 2019 plant die Nagra drei Sondierbohrungen, um den geologischen Untergrund für ein Tiefenlager für radioaktive Abfälle abzuklären.
Versorgung aus dem Untergrund
Christian Meier ist mit der Baustelle an der Universi tätsstrasse zufrieden: «Hier mussten wir zum Glück keine Kanalisationsarbeiten ausführen – das hat uns viel Mühe und Zeit erspart.» Dafür stiess man auf der Baustelle an der Uraniastrasse auf ein Hindernis: Die Bauarbeiten waren bestens vorbereitet, alle Werkleitungsbetreiber hatten ihre Angaben geliefert, doch beim Graben kam ein riesiger Betonklotz zum Vorschein – genau dort, wo die Kanalisation geplant war. Von diesem Klotz hatte nie mand etwas gewusst. Nach langer Suche habe sich her ausgestellt, dass es sich um einen alten Fernwärmekanal handle, der noch in Betrieb ist, aber nie in den Plänen er fasst wurde. «Schliesslich mussten wir die Kanalisation unter der Fernwärme durchführen», sagt Christian Meier. Momente wie dieser gehören beim Bauen im Untergrund zum Alltag. Ob alte Leitungen, die nirgends eingetragen sind, archäologische Funde oder geologische Entdeckungen – der Raum unter der Oberfläche ist beschränkt und voller Überraschungen. Das gehe gerne vergessen, fasst Christoph Braun zusammen: «Man geht aufs WC, drückt auf den Knopf, und alles ist weg. Man dreht am Wasserhahn, betätigt den Lichtschalter – alles funktioniert. Die Versorgung aus dem Untergrund ist so selbstverständlich, dass wir oft auf Unverständnis stossen, wenn wir Strassen sperren und lange graben und bauen müssen.»

Dieser Beitrag stammt aus dem Themenheft «Im Untergrund».
Am 20. März referiert der Architekt und Städtebauer Rainer Klostermann an der Hochschule Luzern im Gespräch mit Rahel Marti über Spielräume für den Städtebau im Untergrund. Anschliessend folgen ein Referat und eine Podiumsdiskussion zum Thema thermische Netze.
Programm und Anmeldung: Planen im Untergrund, Umsetzungsstrategien für thermische Netze Mittwoch, 20. März, 10 Uhr, Hochschule Luzern, Campus Horw
Am Nachmittag findet das 15. IGE Planerseminar statt, unter anderem referiert Hochparterres Redaktor Axel Simon.