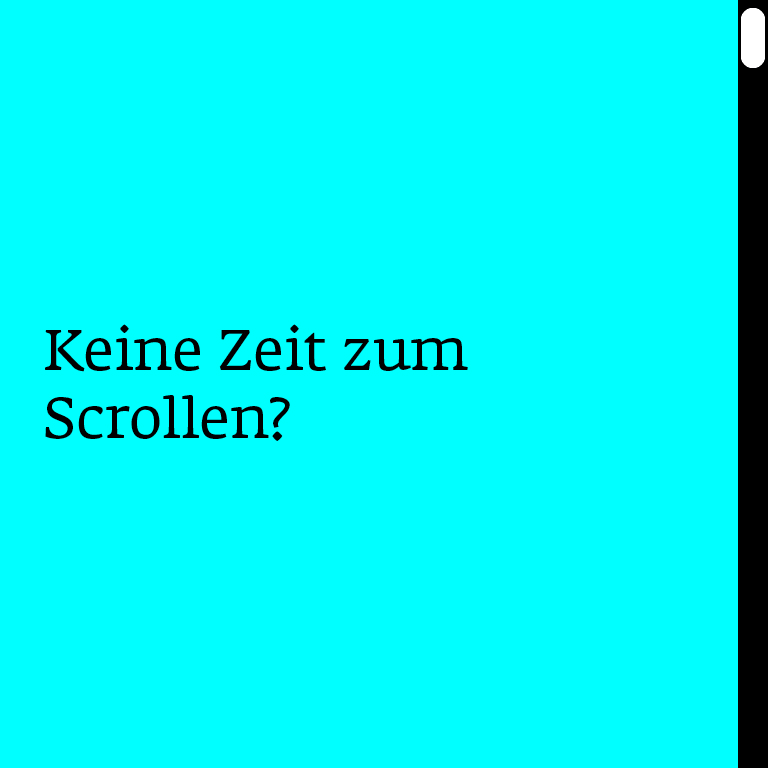Dorf in der Stadt in der Welt
Niklaus Scherr eröffnete als Alterspräsident die neue Legislatur des Zürcher Gemeinderates. Er hielt eine urbanistisch engagierte, gescheite Rede, sprach von den Bedrohungen des Kreis 5 durch megalomane Projekte wie die Europaallee und forderte, dass die Stadt Zürich über ihre Grenzen hinaus denken und planen müsse. Die ganze Rede lesen sie hier.
Niklaus Scherr eröffnete als Alterspräsident zum dritten Mal die neue Legislatur des Zürcher Gemeinderates. Er hielt eine urbanistisch engagierte Rede, sprach von den Bedrohungen des Kreis 5 durch megalomane Projekte und forderte, dass die Stadt Zürich über ihre Grenzen hinaus denken und planen müsse. Lesen Sie die ganze Rede:
Eine Kollegin hat mich irritiert gefragt, warum es in der Einladung heisst, dass «voraussichtlich Niklaus Scherr» die Sitzung eröffne. Es besteht ja wohl kaum ein Zweifel, dass ich das amtsälteste Mitglied dieses Rates bin, schliesslich war ich schon dreimal Alterspräsident. Ob da im Stadtrat jemand an meinem Gesundheitszustand zweifelte?
Ich bin ein Super-Oldie in diesem Saal. Ich werde in wenigen Tagen siebzig und gehöre seit über 35 Jahren diesem Rat an – ein halbes Leben. Ein Drittel meiner Faktionskolleginnen war noch gar nicht geboren, als ich als zorniger junger Mann und Nachfolger des Schriftstellers Walter Matthias Diggelmann in diesen Rat eintrat. Seither habe ich vieles er- und überlebt. Der Start war hart. Jedesmal wenn ich das Wort ergriff, begann eine organisierte Claque auf der bürgerlichen Seite ostentativ mit den Zeitungen zu rascheln, um meine Voten zu übertönen. In den wilden Zeiten der Zürcher Jugendbewegung kam es auch schon mal vor, dass der Ratsweibel auf Anweisung des Ratspräsidenten mir Mikrofon und Manuskript entriss, um mich am Weiterreden zu hindern. Oder ein SP-Ratskollege den Wunsch äusserte, mich mit dem Flammenwerfer zu grillieren. In schwierigen Momenten habe ich immer wieder - die Feministinnen mögen mir verzeihen – zu den Ahnen an der Wand hochgeschaut, um mir dort etwas Trost zu holen.
Das Ritual will, dass ich mich für die Ehre bedanke, die der Rat mit dem Alterspräsidium meinem Wahlkreis erweist. Ich mache das mit zwiespältigen Gefühlen.
Ich vertrete den Chreis Cheib. Hier wohnen viele Menschen ohne Arbeit, grosse Familien mit kleinem Einkommen, Alleinstehende, Suchtkranke, als «illegal» Erklärte aus armen Weltgegenden. Hier wird gedealt, prostituiert, einsam gelitten. Und zugleich sind wir das grösste Apartheid-Quartier in dieser Stadt. Knapp die Hälfte der Menschen, die hier leben, haben weder Stimm- noch Wahlrecht. Ich versuche auch ihnen eine Stimme zu geben.
Ich verfolge mit Unbehagen, wie sich mein Dorf Aussersihl entwickelt. Ein Zangenangriff setzt es auf beiden Seiten unter Druck. Wie ein Keil zwängt sich von Osten die Europaallee vom Bahnhof bis zur Langstrasse ins einstige Armenviertel. Im Westen haben geschichtsblinde Technokraten meinen Güterbahnhof plattgemacht, um an seiner Stelle den PJZ-Repressions-Tempel hochzuziehen. Beides mit dem politischen Segen des grossen Bruders zu meiner Rechten, der uns kläglich im Stich gelassen hat.
Und mittendrin wird gesäubert. Sobald es wieder wärmer wird, müssen in der Bäckeranlage die Quartier-Alkis aus den Heilsarmee-Asylen die Seite wechseln und ihr Bier im Schatten trinken, damit die Mammis und Papis die verkehrsberuhigte Sonnenseite für sich haben und ihre Kinder nicht durch biertrinkende Männer verschreckt oder gar in ihrer Entwicklung gestört werden.
Eine Koalition der Wohlmeinenden und Ahnungslosen hat vor zwei Jahren in diesem Rat das Regulierungs-Korsett namens Prostitutions-Gewerbe-Verordnung PGVO erlassen. Wie immer, wenn Zwingli ruft, stimmten damals auch die alten und die neuen, grün angemalten Liberalen für mehr Staat. Gestützt auf die PGVO werden jetzt Sexarbeiterinnen, die hier seit Jahren selbständig anschaffen, um ihre Familien in der fernen Heimat mitzuernähren und ihren Kindern eine gute Ausbildung und ein Leben in Würde zu finanzieren, aus dem Quartier vertrieben, abgedrängt in die Halblegalität oder in die industriellen Grossbordelle in Dietlikon und Schwerzenbach.
Und nach den Tschinggen sollen jetzt die Arbeiter aus Portugal, Kroatien und dem Kosovo ihre Wohnungen für ein Sanierungs-Lifting und kaufkräftigere Nachfolger frei machen und nach Dietikon und Regensdorf weiterziehen.
Als Tüpfli auf dem i soll jetzt die eh schon dem Agglo-Party-People geopferte Langstrasse auf 200 Metern auch noch autofrei und zum Mini-Veloparadiesli aufgehübscht werden.
All das spielt sich ab unter dem Motto der «Quartieraufwertung». Dieser oft gedankenlos verwendete Begriff gehört ins Wörterbuch des Unmenschen. Aufwerten kann man nur, wenn man das Bisherige als weniger wertvoll erachtet. Aufwertung bedeutet im Klartext: Unwerte oder weniger wertvolle Menschen sollen weg oder zumindest aus dem öffentlichen Raum verschwinden. Und wo aufgewertet wird, steigt vor allem der Wert der Grundstücke. Stets war die Vertreibung der Drögeler, Alkis und Huren aus einem Quartier Auftakt und Startsignal für die Spekulanten: in den 1970er-Jahren im Niederdorf, in den 80ern im Seefeld, in den 90ern im Kreis 5. Im Augenblick ist das «social cleansing» in Aussersihl und Wiedikon im Gang. Das Kartell der Grundeigentümer darf sich bedanken.
All das spielt sich nicht nur hier, sondern stadtweit ab unter dem generalisierten Motto «Erlaubt ist, was nicht stört». Was soll das heissen? Brauchen gewisse Menschen, brauchen gewisse Verhaltensweisen in unserer durchperfektionierten Stadt eigentlich eine Bewilligung zu existieren?
Für mich ist klar: wir brauchen mehr Langstrasse und weniger Europaallee! Eine Langstrasse, wo zwar keine Alleebäume stehen wie am neuen Boulevard Lagerstrasse oder an der Bahnhofstrasse, wo aber noch ein Herz schlägt. Der Puls der Unangepassten.
Für mich ist klar: Wir brauchen wieder mehr Stadt, weniger Vertreibung. In der Stadt ist auch das, was nicht in die Norm passt, sichtbar. Und wir müssen unsere Stadt auch grösser denken. Warum soll ein Kongresszentrum nicht in Dübendorf, eine Fussball-Arena nicht in Schlieren stehen? Das Rote Zürich hat als eine seiner Grosstaten die Eingemeindung von 1934 verwirklicht. Hat unsere rotgrüne Exekutivmehrheit keine stadtgestalterischen Utopien mehr? Genügt es uns, unsere rotgrüne Nische immer mehr Richtung 2000-Watt-Gesellschaft zu perfektionieren? Bräuchten wir nicht – jetzt, wo die Glattalbahn gebaut und die Limmattalbahn in Planung ist – den Mut, über eine erweiterte Stadt nachzudenken, auch wenn wir dafür auf die komfortablen politischen Mehrheiten von heute verzichten müssten?
Nur eben: wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, meint Berufszyniker Helmut Schmidt. Also sage ich zum Schluss eher etwas zur konkreten Arbeit, die Sie in unserem Mittwochsclub erwartet.
Natürlich ist mir bewusst, dass wir hier sozusagen im Theater Limmatblick gastieren und Mittwoch für Mittwoch mehr oder weniger begabte Laienschauspieler einen kleinen Jahrmarkt der Eitelkeiten aufführen. Darüberhinaus ist unser Parlament:
– eine Arena für den öffentlichen Meinungsstreit über den politischen Kurs unseres Gemeinwesens
– die place publique, wo Transparenz hergestellt und Kontrolle ausgeübt wird über das Handeln von Verwaltung und Regierung.
Zum Meinungsstreit muss ich nicht viel sagen. Die Mehrheiten sind Ihnen allen bekannt und bekanntlich auf beiden Seiten äusserst knapp.
Auch wenn das einigen altmodisch erscheint, ich bin ein dezidierter Verfechter der res publica. Zentrale gesellschaftliche Bedürfnisse sollen öffentlich erörtert und öffentlich finanziert werden. Gerade im Zeitalter der Globalisierung sind die Städte wichtige Laboratorien der Zukunft. Die Gestaltung unserer Zukunft gehört nicht in die unsichtbare Hand des Marktes oder in die sichtbaren Hände von Google, Facebook & Co. Sicher: Parlament kommt von parlare, reden. Trotzdem sollten wir alle – nicht zuletzt die Vertreter der Vaterländischen Stammtisch-Partei – eines nicht vergessen: Politik ist mehr Handwerk als Maulwerk. Am Schluss zählen die Taten, nicht die Worte. Vergessen Sie Tele Gilli-Gilli, Politik ist kein Quickie mit einer Halbwertszeit von 20 Minuten. Und was Transparenz und Kontrolle angeht: Schauen Sie dem Stadtrat – auch dem eigenen - auf die Finger, nicht auf den Mund. Generell und noch immer gilt der träfe Satz von Max Weber: »Die Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich.»
Vor knapp fünfzig Jahren habe ich an meiner ersten Demonstration gegen den schmutzigen Krieg in Vietnam teilgenommen. Dass Menschen trotz Rückschlägen sich immer wieder engagieren, um ihre Lebensverhältnisse zu verändern und zu verbessern, erfüllt mich auch heute noch mit Zuversicht. Ich wünsche uns allen Ausdauer, Leidenschaft und Augenmass.