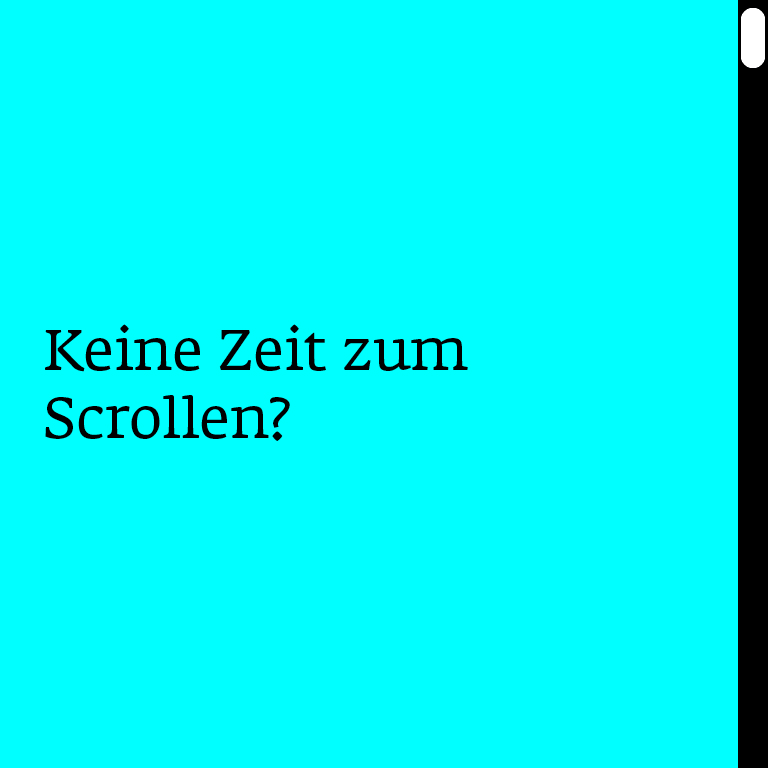Stadt durch Landschaft
Freiraumplanungen sind eine der grossen städtebaulichen Herausforderungen der Zukunft. Nötig sind neue Denkweisen, die breite Zusammenhänge berücksichtigen.
Die Profession der Landschaftsarchitektur hat sich durch den Baukünstler Architekt – der vieles weiss und fast alles kontrolliert – unverständlicherweise aus dem ihr angestammten Paradiesgarten vertreiben lassen. Hinaus in das, was landläufig und ziemlich despektierlich ‹Umgebung› heisst. Was für ein fürchterliches Unwort!
Auch der von Architekten gern verwendete Begriff Aussenraum ist für alle, denen landschaftliche Inhalte nahe und wichtig sind, eigentlich eine Zumutung. Denn ‹aussen› erschliesst sich nur aus dem (architektonischen) Blick von ‹innen›. Landschaftsarchitektinnen sprechen deshalb lieber von Freiraum und betonen damit nicht nur, dass der Raum frei und offen sein soll, sondern genauso, dass er soziale Aspekte aller Couleur beinhalten muss.
In Ballungsgebieten werden die verfügbaren Freiräume generell enger. Deshalb sind umsichtige Freiraumplanungen eine der ganz grossen städtebaulichen Herausforderungen der Zukunft. Der Schweizer Heimatschutz ruft zur Verdichtung mit Qualität auf: Räume werden enger, aber ihre Qualität muss gesteigert werden. Damit rücken wir ganz nahe an die Essenz dessen, was der dänische Architekt und Stadtplaner Jan Gehl in seinem bahnbrechenden Buch ‹Life Between Buildings› schon 1971 herausdestilliert hat, dass nämlich die planerischen Paradigmen umgedreht werden müssen: zuerst das Leben, dann der Raum, dann die Architektur.
Klimawandel stellt neue Fragen
Das ist an sich nichts Neues, enthält aber noch immer gehörig Zündstoff. Doch jetzt, mit der ins Rampenlicht drängenden Thematik des Klimawandels, ist alles nochmals ganz anders geworden. Eine Flut von komplett neuartigen Fragestellungen stellt Paradigmen des Städtebaus infrage: etwa die Winddurchlässigkeit unserer Städte, die auf dem Prüfstand steht. Ebenso ihr viel zu hoher Versiegelungsgrad. Der Mangel an Durchgrünung wird lautstark und zu Recht kritisiert. Verdurstende Bäume müssen mit klimatauglichen Arten ersetzt werden.
Die meisten der neuen Fragestellungen lassen sich mit herkömmlichen Denkweisen nicht beantworten: Wir benötigen Planende, die kompetent sind, die Umwelt positiv zu modifizieren und die nicht nur drei, sondern dreissig Jahre in die Zukunft denken können. Sie müssen sich aber auch auf vorausschauende gesetzliche Grundlagen und Bewilligungsbehörden stützen können. Diese gibt es zurzeit erst in Ansätzen: So wird beispielsweise im Kanton Zürich auf gesetzgeberischer Stufe erwogen, eine Unterbauungsziffer einzuführen. Diese würde das Mass an unterbauter Grundstücksfläche beschränken und die Anpflanzung von grosskronigen Bäumen fördern.
In grossen Dimensionen denken und planen
«Wir müssen Denkweisen erarbeiten, die auch Zusammenhänge von Menschen mit Nichtmenschen, also Pflanzen, Tieren, Böden, berücksichtigen», sagt Teresa Galí-Izard, die neue Professorin für Landschaftsarchitektur an der ETH Zürich. Dazu gehören komplette neue Vegetationsbilder: strukturreich, durchlässig und von hoher Biodiversität. Auch gilt es, den ganzen Wasserzyklus von Niederschlag über den Wasserrückhalt bis zur Versickerung neu zu denken. Deshalb wird der Ruf nach einer ganz anderen Rolle der Landschaftsarchitektinnen und -architekten im städtebaulichen Kontext laut: Sie sind Generalisten, die in vier Dimensionen denken können; die Programmierungs- und Wachstumsprozesse begreifen, initiieren und steuern können. Es sind Fachleute, die Raum nicht nur als Bauparzelle, sondern als weiträumiges Territorium verstehen und auch entsprechend agieren und kommunizieren können.
Nicht zu vergessen ist die Stadt als Lebensraum für Tiere: Unter dem verführerischen Titel ‹Animal-Aided Design› (AAD) hat derzeit eine Bewegung Aufwind, die Raum- und Habitat-Anforderungen einzelner Tierarten in die Stadtentwicklung integriert. Diese leiten sich aus den spezifischen Lebenszyklen der Arten ab: Der Igel benötigt offene Flächen, gut strukturiertes Untergehölz und verkehrsberuhigte Räume. Dann ist es ihm wohl. Gleiches gilt analog für Schmetterlinge, Mauersegler oder Eidechsen. Solcherart tierbezogene Vorgaben haben grossen Einfluss auf den planerischen Entwurf des Freiraums.
So wächst in den turbulenten Zeiten des Klimawandels an vielen Orten ein ganz neues, radikales Bewusstsein von Stadtlandschaft. Es rückt landschaftliche Parameter und Kompetenzen in den Mittelpunkt stadtplanerischer Überlegungen und macht sie zum Identitätsträger, zum Brand. Wie etwa in der Seestadt Aspern am Rand von Wien, einem Vorzeigebeispiel der Internationalen Bauausstellung Wien 2022. Da, wo nicht viel mehr vorhanden war als die leere Donauebene, ist zuerst ein See ausgehoben und dann ein Seepark geschaffen worden. Sie sind das zentrale Kapital der Stadt, die ringförmig um den See heranwächst. Auch die Strassenentwässerung wurde neu erfunden: Vor Ort versickerndes Strassenwasser reduziert die Meteorwasserfracht ganzer Strassenzüge, lässt Sammelleitungen in ihren Durchmessern schrumpfen und ist kostengünstiger zu realisieren. Und: Die (schwarze) Strassenfläche ist mehrheitlich von Bäumen beschattet.
Vorbilder existieren
Nach historischen Referenzen für eine weit in die Zukunft vorausdenkende Rolle der Landschaftsarchitektur muss man nicht lange suchen: Frederick Law Olmsted (1822–1903) hat mit dem Central Park in Manhattan und der Emerald Necklace, einem Zusammenschluss von Parks in Boston, zwei Vorlagen für eine freiräumliche Denkweise geliefert, die ganze Stadtteile antizipiert und initiiert haben. Sie waren und sind identitätsstiftend, stadtstrukturell relevant und weit in die Zukunft blickend. In Berlin hat Peter Joseph Lenné (1789–1866) im ähnlichen Sinne mit Tiergarten, Sanssouci und vielfältigen Alleen das typische Stadtbild zu einem Zeitpunkt geformt, als Berlin noch gar nicht da war.
Gefragt sind in Zeiten des Klimawandels aber nicht nur vorausschauende räumliche Stadtkonzepte, sondern auch radikale und neue Naturbilder. Bilder, die hoffnungsvoll und zukunftsgerichtet sind und den beschaulichen Rousseau’schen Zopf des ‹retour à la nature› umdrehen in ein beherztes ‹Vorwärts zur Natur›. So wird das ureigene Metier der Landschaftsarchitekten – Pflanzplan und Pflanzliste – ganz selbstverständlich zu einem Nachforschen über Pflanzenarten, die auch unter garstigen klimatischen Verhältnissen überleben. Die öffentlich verfügbare Strassenbaumliste der deutschen Gartenämter stellt einen solchen Versuch dar, Arten zusammenzutragen, die auch im heisser, trockener und windiger werdenden Klima überleben können. Bereits gibt es Baumschulen, die sich die Tauglichkeit von Pflanzen für den Klimawandel zuoberst auf die Fahnen geschrieben haben. Es sind aber nicht nur angepasste Arten gefragt, sondern ganz neue und robuste Pflanzenbilder, die weniger nach Eigenschaften der Schönheit als der Klimatauglichkeit und der Biodiversität komponiert sind.
In diesen neuen Projekten spielen Aneignung und Fürsorge eine ganz wesentliche Rolle: Fürsorge bedeutet im Kern, dass immer auch die guten Kräfte mitgedacht werden müssen, die zu Freiräumen die notwendige Sorge tragen. Gefordert sind zukunftstaugliche Narrative, die den fürsorglichen Aspekt des Beschützens und der Pflege einschliessen. Jorn de Précy (1837–1916), der englische Gartenphilosoph, hat das auf überraschende Weise zum Ausdruck gebracht: «Der Garten hat den Menschen gemacht.» Die zarten Pflänzchen und Pflanzen haben aus der Bestie Mensch ein fürsorgliches Wesen gemacht, eines, das Sorge tragen und Fürsorge ausüben kann. Dieses Hegen und Pflegen ist eigentlich der Kern unseres Kulturbegriffs – in einem zutiefst menschlichen Sinn. Er ist aus der Landwirtschaft abgeleitet, die ganz nach dem Rhythmus von säen, heranwachsen, pflegen und ernten funktioniert. In diesem Sinne ist auch die vehemente Forderung von chinesischen Eliteuniversitäten zu verstehen, dass städtische Landschaften und Freiräume weniger dekorativ als vielmehr produktiv sein müssen. Gemeint ist, dass auch Stadtgrün einen wichtigen Beitrag zur Ernährung der Städter zu leisten hat. Die ‹essbare Stadt› ist auch hierzulande ein bekannter Begriff – bisher aber nur in den Kochbuchregalen der Buchläden.
Stefan Rotzler hat sein Studium 1978 am Interkantonalen Technikum Rapperswil abgeschlossen, dem Vorläufer der OST. Bis 2014 führte er das Büro Rotzler Krebs Partner Landschaftsarchitekten (mit Matthias Krebs und Stephan Herde) in Winterthur. Heute ist er selbstständiger Berater und Landschaftsarchitekt.