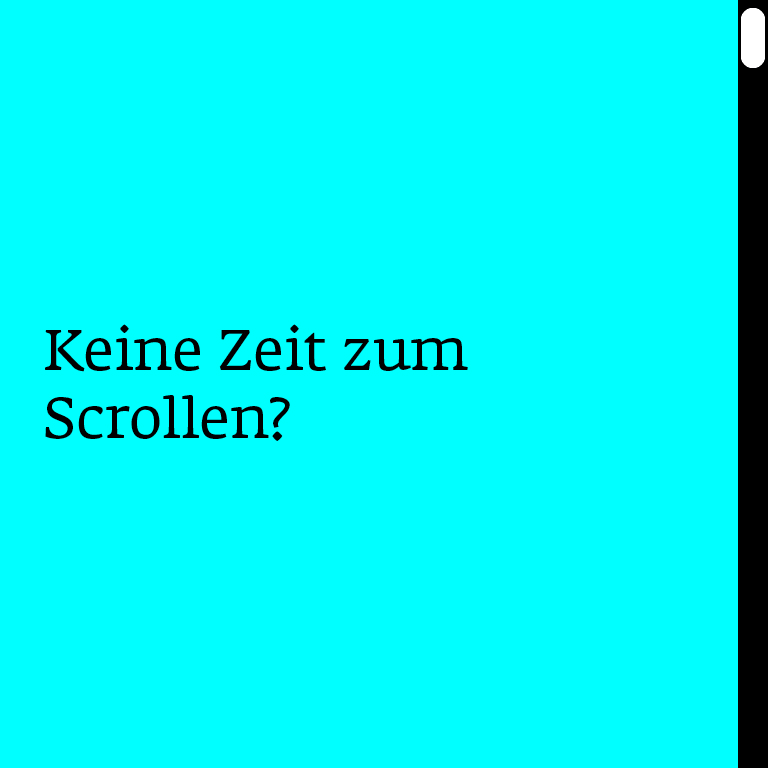Zwei Paar Schuhe
Eine Ausstellung folgt Bally von Paris im 19. Jahrhundert bis auf den heutigen Mailänder Laufsteg. Zwei Schuhdesigner kommentieren die Geschichte in fünf Stationen.
Dunkles Rot und Blau dämpfen den Raum. Die Szenografie, die mit einer angedeuteten Fabrik, einem Laden und einem Platz an eine kleine Stadt erinnern soll, entfaltet das Archiv des Herstellers Bally. 800 Exponate sind zu sehen: klassische Lederschuhe, zarte Seidenpumps oder Sneakers in Popfarben, aber auch Modezeichnungen und Maschinen, die das Leder vermessen und formen. Das Museum für Gestaltung Zürich zeigt auf 492 Quadratmetern 168 Jahre Bally-Geschichte.

Seit sechs Jahren entwerfen und verkaufen Stefan Rechsteiner und Patrick Rüegg Schuhe unter ihrem Label Velt. Der Name erinnert an den ersten Produktionsort: Gefertigt wurden die Herrenschuhe zu Beginn im aargauischen Dorf Veltheim. Heute stehen die Maschinen, auf denen das Leder über den Leisten gezogen und an die Sohle gezwickt wird, im benachbarten Othmarsingen. Das ist zwanzig Minuten von Schönenwerd entfernt, wo einst Bally stanzte, nähte und klebte. Nun stehen die Schuhdesigner Rechsteiner und Rüegg im ersten Ausstellungsraum des Museums für Gestaltung im Toni-Areal. Entlang fünf Kapiteln wollen sie herausfinden, wie das Geschäft mit dem Schuh einst lief, was heute noch gleich ist, und ergründen, weshalb ihr Idol Bally eine verstaubte Note hinterlässt.
Die Firma
Die erste Station erzählt die Firmengeschichte. Über vier Generationen produzierte Bally in Schönenwerd. 1976 verkaufte die Familie ihr Erbe dem Spekulanten Werner K. Rey, der die Firma neun Monate später an den Rüstungskonzern Oerlikon-Bührle weiterreichte. 1999 übernahm die US-Investmentgesellschaft Texas Pacific Group. Seit zehn Jahren hält die deutsche JAB-Holding der Milliardärsfamilie Reimann die Mehrheit. Der Firmensitz liegt in der Tessiner Grenzgemeinde Caslano, das Designstudio in Mailand. Bald schon wird Bally chinesisch. Der Bekleidungskonzern Shandong Ruyi will mit dem Kauf in die Liga von Richemont und LMVH aufsteigen – weil das Geschäft aber noch nicht abgeschlossen ist, sei davon in der Ausstellung im Museum für Gestaltung nichts zu sehen und zu lesen, sagt die Kuratorin Karin Gimmi.

Stefan Rechsteiner: Ich bin begeistert und bewundere, wie Bally Fachwissen mit cleverem Unternehmertum vereinte. Unglaublich, wie offen und fortschrittlich die Firma bereits in den Gründerjahren um 1851 war. Sie holte die neusten Maschinen aus Amerika und investierte früh in neue Technologien. Doch dafür brauchte es in erster Linie finanzielle Mittel. Bei uns, bei Velt, läuft es seit drei Jahren gut: Nun können wir investieren, haben vor einem Jahr unsere Kollektion um Damenschuhe und -taschen erweitert. Inzwischen arbeiten bei uns in Berlin fünf Leute in Design, Einkauf und Marketing. Eindrücklich ist, wie die Firma Bally das Schuhmachen in der Schweiz geprägt hat. Wir lernen in unserem Alltag immer noch Leute kennen, die einst für Bally gearbeitet haben. Heute allerdings ist die Marke eine nostalgische Angelegenheit. Ein Neustart wie ihn Balenciaga gewagt hat, täte gut.
Patrick Rüegg: Genau. Die Geschichte der erfolgreichen Schweizer Schuhfirma ist zwar spannend, aber die aktuellen Bally-Modelle inspirieren nicht. Hier ist viel Tradition zu sehen, zeitgemässes Design fehlt, vor allem bei den neuen Entwürfen. Aber ich bewundere die Haltung, auf hochwertige Materialien und eine sorgfältige Machart zu setzen. Dennoch zeichnete sich der Lohndruck auch bei Bally früh ab: 1964 waren etwas mehr als die Hälfte der Angestellten Fremdarbeiterinnen und -arbeiter, nach und nach verlegte die Firma die gesamte Produktion ins Ausland. Auch verdrängten in den Siebzigerjahren günstigere, vulkanisierte Gummisohlen das teure Leder. Heute in der Schweiz zu produzieren, ist kaum mehr möglich: Es gibt Schuhe für vierzig Franken zu kaufen – wir kaufen dafür gerade mal unser Material ein. Der einzige Weg war und ist deshalb das Premiumsegment.
Stefan Rechsteiner: Luxus ist die Zukunft. Louis Vuitton macht jedes Jahr mehr Gewinn – mit ultrahohen Preisen. Allein der Name ist 48 Milliarden Franken wert, mehr als die Marken Chanel, Rolex und Prada zusammen. Auch als Gestalter haben wir im Hochpreissegment mehr Freiheiten, wir müssen nicht überlegen, welches Leder wie viel kostet. Dafür benötigen wir mehr Geld im Verkauf mit hochwertigen Verpackungen oder einer stets aktuellen Website. Das zeigt auch die Ausstellung, Bally engagiert für die Ladenlokale eigene Architekten und hatte schon früh eine eigene Werbeagentur. Zahlte JAB 2008 noch 390 Millionen für Bally, so zahlen die chinesischen Investoren nur zehn Jahre später schon doppelt so viel.
Die Fabrik
Carl Franz Bally entschied gegen die Proteste der lokalen Schuhmacherzunft, die Produktion von Schuhen in einzelne Arbeitsschritte aufzuteilen und auf Maschinen zu setzen – zuerst auf Stanzautomaten, später auf Schaft- und Sohlennähmaschinen. Energie lieferte zuerst eine Dampfmaschine, später eine vom Aarekanal angetriebene Turbine. Produzierte das Unternehmen 1881 täglich 3157 Paar Schuhe, waren es 1900 bereits 6800. Später erwarb Bally im grossen Stil Fabriken und Gerbereien ausserhalb der Schweiz. In Caslano werden heute noch Herrenschuhe und Sneakers hergestellt, die restliche Produktion findet in Norditalien statt.

Patrick Rüegg: Gewisse Dinge bleiben über all die Jahre gleich. Die vielen verschiedenen Absätze etwa. Einziger Unterschied: Die in Zürich ausgestellten sind aus Holz und Kork, unsere heute aus Kunststoff. Auch unsere Sohlen sehen aus wie damals, nur die eingeprägte Grafik ist zeitgemässer. Unterschiede erkenne ich hingegen bei den Leisten. Die frühen waren von Hand aus Holz gefertigt und wirken geometrisch. Unsere Leisten sind komplexer geformt, mit mehr Freiformen und Wölbungen, gezeichnet am Computer. Die Arbeitsschritte sind ungefähr dieselben. Der Maschinenpark unserer Produktion ist dreissigjährig: Bis heute sind für Schuhe rund hundert Arbeitsschritte nötig, Leder bleibt das wichtigste Material. Bei Turnschuhen wäre das anders, da sind die Maschinen, Materialien und Technologien neu. Einzig die Sohlen nähen wir nicht mehr an, der Klebstoff ist heute besser als früher. Kleben hat zudem den Vorteil, dass wir die Sohle entfernen und ersetzen können – wir plädieren dafür, Schuhe so oft als möglich zu reparieren, das macht sie erst nachhaltig.
Stefan Rechsteiner: Was Recycling angeht, sind Schuhe ein schwieriges Produkt, weil es aus vielen unterschiedlichen Materialien besteht. Nachhaltigkeit oder ein Verhaltenskodex, wie wir ihn definiert haben, sind in der Ausstellung nicht zu finden und scheinen bei Bally kein Thema gewesen zu sein. Die Gesellschaft schien lange Zeit anderes zu interessieren. Fortschrittlich war 1885 allerdings Ballys interne Betriebskrankenkasse, sich in einer Gewerkschaft zu organisieren, war den Arbeitenden aber lange verboten.
Die Werbung
1852 erschien Ballys erstes Inserat, Verpackung und Schuhe wurden bereits früh mehrsprachig etikettiert. Ab 1932 übernahm die eigens gegründete Firma Agor das Reklamewesen und prägte so mehr als vierzig Jahre das Erscheinungsbild. Aktuell wirbt Bally digital mittels Influencern, bewegten Bildern und setzt auf das Argument Schweiz.

Stefan Rechsteiner: Die Bally-Plakate stellen pointiert auch unsere Frage: Wie zeigen wir Schuhe auf einem Foto? Ein Schuh, der alleine steht, kann langweilig wirken. Trägt ihn jemand, machen wir mit dem Outfit der Models sofort ein konkretes Bild zum Träger oder zur Trägerin. Deshalb finde ich die Plakatreihe ‹Le pas vers la mode› von Wiener Deville Wälchli und dem Fotografen Jost Wildbolz von 1978 toll. Die Plakate geben eine schemenhafte Idee der Träger, vermitteln eher ein Gefühl denn ein konkretes Outfit. Erstaunlicherweise entstand erst um 1989 das erste Corporate Design – davor war der Schriftzug überall anders, und man verwendete unterschiedliche Logos. Ein Bewusstsein für eine Firmenidentität setzte spät ein.
Patrick Rüegg: Unsere Werbemedien sind anders. Die Mittel allerdings sind ähnlich. So arbeitete Bally etwa bei der Mount-Everest-Erstbesteigung mit Sherpa Tenzing Norgay zusammen, der ihre Rentierstiefel trug. Oder Bally sponserte Olympioniken. Auch heute gilt es – vor allem in der Mode – wichtige Leute zu gewinnen, die deine Sachen tragen, oftmals geschenkt. Wir haben das auch schon probiert. Fürs Image ist Instagram wichtig. Doch auch hier ist der Schuh ein undankbares Objekt – ihn in die Kamera zu halten, ist nicht sexy. Eine Sonnenbrille ist dankbarer, die sitzt im Gesicht.
Die Mode
Der Schnürstiefel bildet bis etwa 1920 den Grundtypus vieler Alltags- und Arbeitsschuhe. In den Zwanzigerjahren richtet sich die Firma unter Max Bally stärker auf internationale Mode aus. In Schönenwerd entstand eine ‹Création› mit Studios in Zürich, London, Paris und New York. Setzte Bally ab den Neunzigerjahren vermehrt auf externe Designer, entwirft nun wieder ein eigenes Kreativteam in Mailand. Aktuell dreht sich vieles um Sneakers und Schuhe im Retro-Stil.

Patrick Rüegg: Unglaublicherweise startete Bally erst 1976 mit einer eigenen Taschen- und Kleiderkollektion. Der Schuh braucht immer einen Kontext, damit er erfolgreich verkauft werden kann. Gerade im Luxusbereich ist Mode Mittel zum Zweck. Bei Funktionsschuhen ist das sicher anders. Der Entscheid für eine eigene Modekollektion fiel kurz vor dem Verkauf an Werner K. Rey. Das zeigt, dass Bally etwas ändern wollte oder verpasst hatte. Ich empfinde die Marke gerade in jener Zeit als modern, mit der Plexiglaskollektion etwa, die sie an der Muba zeigte.
Stefan Rechsteiner: In den Neunzigerjahren verpasste Bally den Anschluss, das zeigt ein Schnürstiefel aus Stoff mit Pfennigabsatz – die Designer besannen sich zu sehr auf ihre alten Tugenden, bedienten die Bedürfnisse der Upper Class, anstatt Neues zu schaffen. Das Problem daran: Es gibt keine Zukunft.
Patrick Rüegg: Toll ist die durchwegs hochwertige Verarbeitung. Das zeigen etwa goldene Abendschuhe: Ballys Designer veredelten das Leder mit einer Auflage aus echtem Gold. Wir probieren das auch gerade. Wir starteten experimentell und reduzierten dann markant, um sparen zu können. Nun läuft es wieder, und wir können unser Spektrum öffnen: Mit echtem Gold zu arbeiten, wäre grossartig. Auch haben wir eine Accessoire-Linie lanciert. Interessant sind die anderen Regeln, die für Taschen gelten. Der Schuh ist Gebrauchsgegenstand, für eine Tasche geben die Leute viel mehr Geld aus. So müssen wir das Leder aufwendiger verarbeiten: Kanten, die bei Schuhen einfach gebugt werden, sind bei Taschen kostbar veredelt.
Der Verkauf
Weltausstellungen waren im 19. Jahrhundert die grossen Schaufenster. Dafür reiste Bally nach Paris oder nach Philadelphia. Nach dem Ersten Weltkrieg baute das Unternehmen ein Netz eigener Geschäfte: Ab 1926 war die Tochterfirma Arola für den Ausbau der Bally-Läden zuständig. 1986 eröffnete das erste Geschäft in China. Bis heute setzt Bally auf eigene Lokale an guter Geschäftslage, den Sitz an der Bahnhofstrasse 66 in Zürich mit den denkmalgeschützten Kugeln hat Bally aber dem spanischen Modegiganten Zara überlassen.

Patrick Rüegg: Bereits 1870 gab es ein Bally-Geschäft in Montevideo. Heute kaum zu glauben, aber die Schönenwerder und die Zürcherinnen waren wohl zu wenig mondän für teure Schuhe, die deutsche Gemeinde in Uruguay, die Damen in Paris und die Herren in London aber schon. Bally exportierte 1916 bereits sechzig Prozent aller Waren. Doch auch das nationale Netz überrascht: Die Firma hatte bald 73 Verkaufsstellen, das sind drei pro Kanton – wir haben in der Schweiz gerade mal zwölf Velt-Verkaufsstellen und finden das eine gute Abdeckung. Natürlich gab es keinen Onlinehandel. Dennoch beschäftigt Bally auch heute immer noch 1000 von 1500 Angestellten im Verkauf. Wie wichtig der Verkaufplatz ist, zeigen auch die aufwendigen Interieurs: Es braucht das Erlebnis. Das war bei Bally schon früh so: Die Architektur der Läden war prägend. Mir gefällt dieses eine Bild, auf dem der Verkaufsraum einer Bank gleicht, alle Schuhe fein säuberlich in eigenen Schliessfächern verstaut.
Stefan Rechsteiner: Eigene Läden sind auch für uns ein Thema, es braucht den direkten Kontakt. So können wir Geschichten anders erzählen. Auch die grossen Onlineplayer wie Zalando eröffnen Ladenlokale.
Stefan Rechsteiner und Patrick Rüegg
Die Designer Stefan Rechsteiner (39) und Patrick Rüegg (36) arbeiten seit ihrem Studium in Aarau gemeinsam. Heute entwerfen sie in ihrem Studio in Berlin Herrenschuhe und Damenhandtaschen. Vor zwei Jahren haben sie eine verstellbare Sohle entwickelt, die ihnen ermöglichen soll, die Anzahl der Produktionsformen von den üblichen 14 auf 5 zu reduzieren. Das verringert die Kosten und erhöht die gestalterischen Möglichkeiten auch für kleine Auflagen, siehe Hochparterre 10 / 16.
Dieser Beitrag stammt aus der Ausgabe 5/2019 der Zeitschrift Hochparterre.
‹Das Geschäft mit dem Schuh›
Ausstellung bis 11. August im Museum für Gestaltung Zürich im Toni-Areal,
Pfingstweidstrasse 96, Zürich.
Die Szenografie stammt von Alain Rappaport.