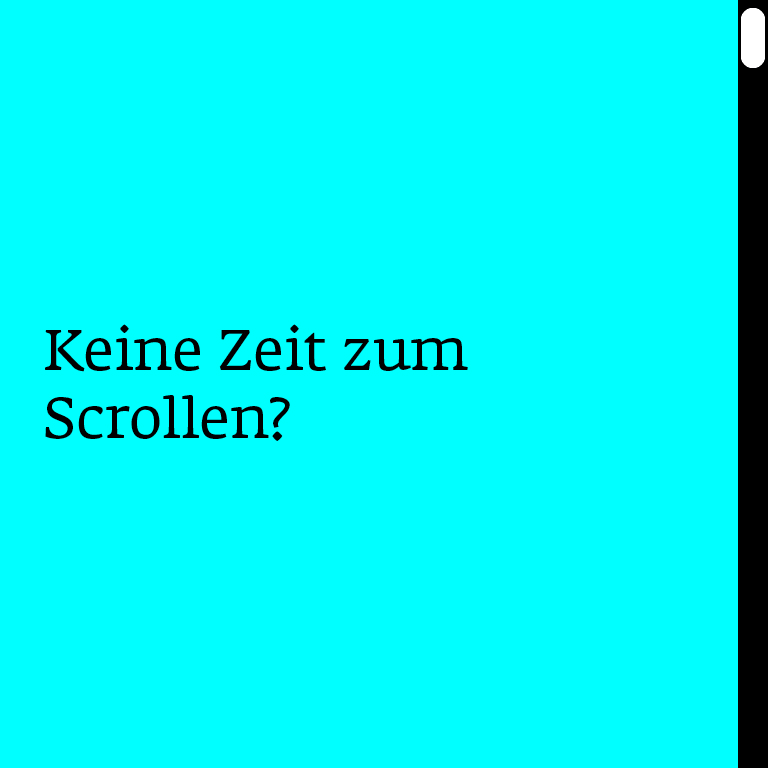Die Ausstellung Videogames: Design/Play/Disrupt stellt besondere Beispiele vor, darunter Journey, 2012
Entwickeln, spielen, neu erfinden: Eine gross angelegte Ausstellung im Victoria and Albert Museum in London widmet sich den letzten fünfzehn Jahren des Game Design.
Die Gewerke, die es für ein Videogame braucht, sind so zahlreich wie einst für den Bau einer Kathedrale. Es braucht die Autorin, welche die Geschichte schreibt, den Illustrator, der die Figuren zeichnet, es braucht Fachleute für den Code und die Animation, für die Programmierung, die Musik und die Vermarktung. Es braucht die Kritiker inner- und ausserhalb der milliardenschweren Branche und der Akademie. Und nicht zu vergessen: die Spielerinnen und Spieler. Allen diesen Akteuren widmet sich die Ausstellung «Videogames: Design/Play/Disrupt» im Victoria & Albert Museum. Allerdings kommt, wer im Spielen erfahren will, was Game Culture ist, nur am Schluss auf seine Rechnung, in einer Sektion, die als Arcade Punk überschrieben ist und aufgetunte, gebastelte Spielautomaten als Gegenkultur innerhalb der lange als Gegenkultur behandelten Games vorstellt. Das will die Ausstellung ändern: Sie nimmt Games als kulturellen Beitrag ernst. Ihr Beobachtungszeitraum beginnt Mitte der Nullerjahre und setzt damit einen historischen Anfang. Davor, so die implizite Botschaft, waren die Games nicht komplex genug, um als Kulturleistung durchzugehen. Pacman oder Supermario sucht man deshalb vergebens.

Screenshot von Journey, Sony Interactive Entertainment LLC
So arbiträr, wie diese historische Setzung erschienen mag, so überzeugend ist sie im ersten Teil der Ausstellung umgesetzt. Die Kuratoren wählten in der Sektion «Design» acht Beispiele, welche die ganze Bandbreite des Genres skizzieren: Die Ausstellung beginnt mit der poetischen Abstraktion von «Journey», einem Game, das uns in eine asiatisch anmutende Landschaft führt, in der die Figur einen Gipfel erreichen muss, allein oder mit Mitstreiterinnen. Mit der Figur identifzieren wir uns sofort. Die stufenweise Abstraktion wird in den Figurenskizzen ablesbar, aber auch in den Fotos der Recherche über Bewegungsmuster, die das Team in Sanddünen überprüfte. Notizen, Story- und Moodboards, Skizzen und Prototypen machen anschaulich, was es braucht, ein Game zu entwerfen.

Installationsansicht zum Game Splatoon, 2015
«Splatoon» wurde 2015 für die Plattform Wii U entwickelt – trotz des Namens, der Splatter mit Platoon verbindet, ein durchaus familienfreundliches Shooter Game. Die kindlichen Figuren ballern nicht mit Munition, sondern mit Tintenpatronen, und je mehr Tinte versprtizt wird, desto besser, denn darin können sie sich verstecken. Im Design an Nintendo-Figuren angelehnt, agieren sie in einem urbanen Setting: der Ort, wo sich die Figuren treffen und interagieren, erinnert an Shibuya, die Kreuzung in Tokyo, an der sich seit den 1980ern die Modefreaks treffen und den Streetstyle in stets neue Verästelungen weiterentwickeln.

Skizze zu Bloodborne.
Wie unterschiedlich nicht nur der zeichnerische Stil, sondern auch die Spielmotivation angelegt ist, zeigt das ebenfalls 2015 herausgebrachte Game «Bloodborne». Hier geht es um den Kampf gegen furchtbare Ungeheuer, geschlagen wird er in einer präzisen, gleitenden Choreografie vor den Kulissen einer Steampunk-satten, viktorianisch anmutenden Stadt namens Yarnham. Egoshooter und Gewalt sind untrennbar mit dem Medium verknüpft, weshalb, wird im zweiten Teil der Ausstellung diskutiert. Doch niedermachen, das ist nur eine Seite. Es geht auch darum, Welten aufzubauen. Selbstverständlich darf deshalb «Mine Craft» (2009/2011) nicht fehlen – die unüberblickbare Spielwiese, die Welterschaffungsträume in Spielenergie übersetzt.

Stand Pate: René Magritte, Le Blanc Seing, 1965
Die Umsetzung jeder Spielidee lebt von den Assoziationen, welche die Umsetzung aufruft. Ein Game wie «Kentucky Route Zero» profitiert stilistisch ebenso vom Surrealismus eines Magritte wie es in der Narration auf Novellen von William Faulkner verweist oder einzelne Szenen in Volker Schlöndorffs TV-Verfilmung von «Tod eines Handlungsreisenden» aufruft. Als Kunstform profitiert Game Design ebenso von Bestehendem, wie es eine eigenständige, neue Form der interaktiven Erzählung eröffnet.

Die Inszenierung führt das Publikum auch räumlich in die Welt der Videogames.
Die Szenografie der Ausstellung führt das Publikum auch räumlich in die Welt der Videogames. Die reflexive Distanz wird aber stets gewahrt. Das wird vor allem im zweiten Teil der Ausstellung klar: Vorgestellt werden hier Games, die soziale und politische Absichten verfolgen – und die deswegen auch zensuriert werden, wie ein palästinensischer Spielentwickler im gefilmten Interview erzählt. Zusammen mit weiteren Exponenten und Interpretinnen steht er auch dafür ein, dass Game Design weit mehr als Unterhaltung ist. Neben ihm sprechen Kritikerinnen, Gameentwickler oder Akademikerinnen über den Zusammenhang von Waffen und Games, Männerdominanz in der Branche, Repräsentation, Sex, Rassismus, Sprachenvielfalt oder Politik.

In der Sektion Play geht es zur Sache.
Im letzten Ausstellungsteil wird nun tatsächlich gespielt. Es blitzt und blinkt und scheppert aus den Spielautomaten, die Atmosphäre erinnert an Spielhallen. Aus einem alten Auto lässt sich trefflich ein Rennen-als-Videogame fahren, und wer wild und punkig basteln will, kann das auch bei Games tun. Hier wird deutlich, dass Games auch eine kollektive Erfahrung sind: Zuschauen macht zuweilen ebenso viel Spass wie selber die Knöpfe zu drücken. Dazu braucht es nicht gleich ein ganzes Stadium wie in Peking, als 90'000 Zuschauerinnen und Zuschauer das Finale von «Leagues of Legends» mitverfolgt haben. Game Culture ist längst Teil unseres Alltags. Selbst wer ohne allzu viel Spielerfahrung diese Ausstellung besucht, realisiert, wie vielfältig und breit Game Design angelegt ist.
Videogames: Design / Play / Disrupt
Victoria and Albert Museum, London
bis 24. Februar 2019
Katalog zur Ausstellung:
Videogames: Design / Play / Disrupt, ed. by Marie Foulston and Kristian Volsing, London: V&A Publishing, 2018