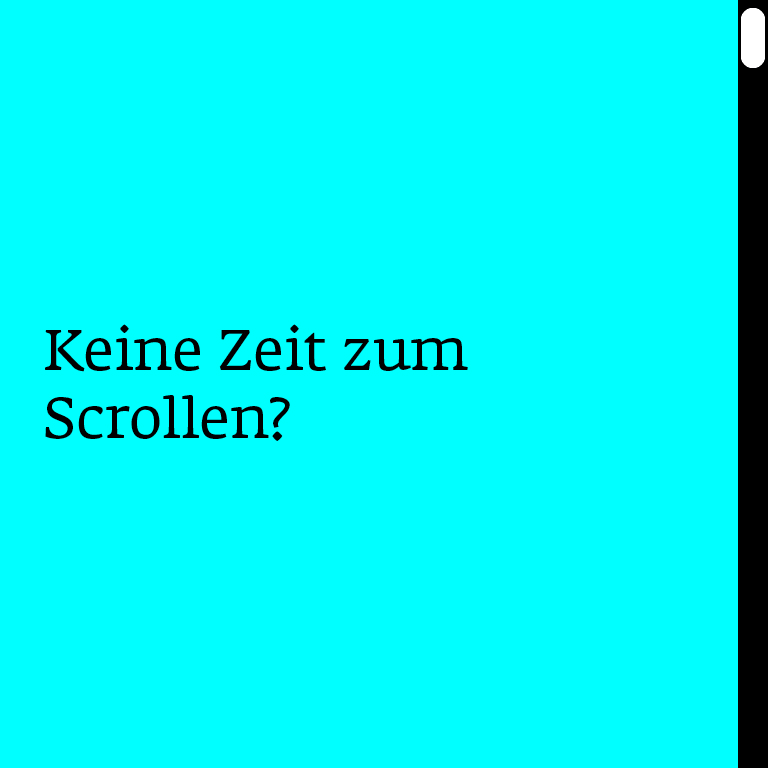Kleider aus der Dior Linie. Foto: Adrien Dinard
Die Schlange ist eindrücklich. Sie zieht sich über die schwarz lackierte Treppe im neuen Sainsbury Wing in die Tiefe bis zum Eingang. Die Schau ist Stadtgespräch, und regelmässig ausverkauft. Das Victoria & Albert Museum hat sie aus Paris übernommen und scheute keinen szenografischen Aufwand, die Heldengeschichte des französischen Couturiers zu erzählen, der die Engländer mochte – und sie ihn, so scheint es. Verzückte Ausrufe, kennerische Blicke, von älteren Damen, aber auch von jungen, exzentrisch gekleideten Fashion students. Die Fassade des ersten Modegeschäfts von Dior an der Avenue Montaigne 30 empfängt die Besucherinnen und wenigen Besucher. Die Schau beginnt mit dem fulminanten Auftritt, mit dem Christian Dior seine glücklosen Versuche als Galerist aufgab und sich nach seiner Tätigkeit als Modeillustrator definitiv der Mode zuwandte und selber kreierte.

Die Ausstellung beginnt mit dem New Look, vor der rekonstruierten Fassade des ersten Verkaufslokals an der 30 Avenue Montaigne in Paris. Mittig platziert das ikonische Bar Kostüm. Foto: Adrien Dirand
Im Februar 1947 stellte er seine erste Kollektion vor, die als New Look Furore machte. Kondensiert ist er im Bar Kostüm: ein unbeschreiblich tailliertes, streng wirkendes Oberteil aus crèmefarbener Shantung-Seide über einem schamlos ausschwingenden, dreiviertellangen schwarzen Plissé-Jupe. «Ich betonte die Taille, gab der Hüfte Volumen und unterstrich den Busen.» Damit beschrieb der Konstrukteur eines betont weiblichen Körpers sein Programm, dem er treu bleiben sollte. Ein Skandal, denn so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Rationierung der Stoffe an allen Ecken und Enden zu spüren war, schien sein Vorschlag die pure Provokation. Sie setzte Paris wieder auf die Landkarte der Modestädte.

Im künstliche Garten hängen die Glyzinen aus Papier in dichten Trauben. Foto: Adrien Dirand
Die Instagrammability der Ausstellung ist hoch. Nach der Pariser Avenue wechselt die Szenerie in einem historistischen Palast, mit Kostümen inspiriert von der Belle Epoque, als ginge es um ein Märchen. Es folgt der Garten von Dior’s Familiensitz Granville in der Normandie. Weisse Glyzinen aus Papier hängen in dichten Trauben von der Decke, dazwischen duftige Kostüme von berückender Leichtigkeit.

Yves Saint Laurent vor dem Laden Christian Diors in London, 1958. © Popperfoto/Getty Images
Nach dem frühen Tod 1957 von Dior schliessen sich die sechs Kreativ-Direktoren an. Ihre Entwürfe passen nahtlos in die von Dior selber kreierten Haute Couture-Kreationen. Doch wer genau hinschaut, stellt Unterschiede fest. In einem Ausstellungsraum werden sie alle vorgestellt. Yves Saint Laurent brachte eine coole Strenge in die Silhouetten. Marc Bohan frischte in den 1960er-Jahren die Eleganz mit einem Hauch Gegenkultur auf. Gianfranco Ferré spielte mit den Farben, John Galliano trumpfte mit theatralischen und provozierende Stylings auf, Raf Simon antwortete darauf minimalistisch. Und schliesslich – als bisher einzige Frau in der Verantwortung – zeigt die amtierende Grazia Maria Chiuri ihre entspannt emanzipierte Interpretation von Diors Ästhetik.

Der Blick ins «Atelier» mit Diors Schnitten. Foto: Adrien Dirand
Ein Raum, ganz in Weiss, ist dem Schneiderhandwerk gewidmet. Hier wird die Typologie von Diors Silhouetten und Formen durchdekliniert: von Blütenkelch- zur Kuppel-, von der Maiglöckchen- zur Bleistift-Linie, später folgt das Alphabet mit der H- zur A- und zur Y-Linie, welche die A-Linie wieder auf den Kopf stellte. Raumhoch werden die Muster in Baumwollstoff in Nischen präsentiert. Doch wer die Kleider bei Dior und unter welchen Bedingungen im Atelier genäht hat und immer noch näht – das lässt die Ausstellung weg. Ebenso wie den Blick auf Gesellschaft oder (Geschlechter-)Politik, auf den unmenschlichen Druck auf die Kreativdirektoren oder auf John Gallianos unrühmliches Ende 2011, nachdem er in einem Pariser Restaurant einen antisemitischen Ausfall produzierte.

Im Ballsaal feiert sich die Mode unter Auschluss von allem anderen selbst. Foto: Adrien Dirand
Das Team um Ausstellungsmacherin Oriole Cullen blendet diese Themen komplett aus. Und so bleibt bis im letzten Raum, der als Ballsaal inszeniert ist und auf einem riesigen sich drehenden Podest die Galakleider der Stars zeigt, ein leichter Überdruss: zu viel Schönes gesehen, zu viel süssen Augenzauber gekostet. Und so kommt der Verdacht nicht von ungefähr, dass der Luxuskonzern LVMH, zu dem die Marke Christian Dior gehört, nicht ganz unschuldig ist an dieser gar unkritischen Sicht der Dinge.
Queen of Pop: Mary Quant
Das passiert in der anderen, gleichzeitig präsentierten Fashion-Schau im Victoria & Albert Museum nicht: hier geht es um den zeitgeschichtlichen Kontext, in dem Mode entsteht. Mary Quant ist dafür ein besonders geeigngetes Beispiel. Die Modemacherin hat den Pop in die Mode gebracht. Als Unternehmerin hat sie aus der Idee, jungen, berufstätigen Frauen unkomplizierte, aber attraktive Mode anzubieten, eine Marke gemacht und gezeigt, dass sich Mode nicht nur an der Haute Couture ausrichten muss.

Mary Quant mit ihrem Mann Alexander Plunket Greene. Foto: John Cowan, 1960
1955 eröffnete sie zusammen mit ihrem späteren Mann Alexander Plunket Greene und dem befreundeten Archie McNair die Boutique Bazaar an der King's Road im angesagten Stadteil Chelsea. Filmausschnitte zeigen, wie Kundinnen mit Papiertüten den Laden verlassen und sich noch Jahrzehnte später nicht nur an ihre Lieblingsstücke, sondern auch an die fantasievollen Schaufenster des Bazaars erinnern. Mehr als achthundert Personen sollen sich auf den Aufruf des V&A unter dem Hashtag #wewantquant mit Geschichten, Kleidern und Accessoires gemeldet haben, berichten die Kuratorinnen Jenny Lister und Stephanie Wood. Daraus haben sie 30 ausgewählt, die ihre Stücke, Erinnerungen und Fotos in die Ausstellung einbrachten.

Regenmäntel aus der Wet Collection, 1963.
Mary Quant kreierte Kleider, die sie selber gerne anzog – einen Regenmantel und flache Stiefel aus PVC, einem Material, das man bis dahin nur als Bodenbelag oder als Tischdecke verwendet hatte. Ihre Wet Collection stellte sie in ihrer ersten Pariser Show 1963 vor. Zwei Jahre später tourte sie durch Amerika und brachte ihre günstigere Linie Ginger Group beim amerikanischen Warenhaus JC Penney unter. 1966 wurde ihr von der Queen einen Orden verliehen, den sie selbstverständlich in einer ihrer eigenen Kreationen entgegennahm und so die Street fashion in den Palast brachte.

Mary Quant und Modelle an der Lancierung der Quant Afoot footwear collection, 1967.© PA Prints 2008
Doch die beiden Kuratorinnen reduzieren Mary Quant weder auf den Minirock, den Twiggy bekannt machte (und geben stattdessen Courrèges die Credits für die Erfindung des hochgerutschten Rocksaums), noch auf den typischen Mary-Quant-Stil oder auf das abstrahierte Margariten-Logo, das die Makeup-Linie zierte, oder auf die farbiggemusterten Strumpfhosen, mit denen die langen Beine unter den kurz geschnittenen Röcken besonders gut zur Geltung kamen.

Die Anfänge von Mary Quant, gezeigt in einer Szenografie, die an Schaufenster erinnert.
Die Kuratorinnen zeigen auch, wie die junge Modedesignerin ihre Karriere mit Schürzenkleidchen und Faltenröcken, die über die Knie reichten, begann. Die Differenz zum Tweedkostüm der Mütter war gross genug: Der kleine Laden an der King's Road florierte. Sie vermitteln auch, wie Mary Quant die Prinzipien der Serienproduktion nutzte, um möglichst vielen Frauen die Möglichkeit zu geben, mit Kleidern Identität auszudrücken. Dazu gehörte Sexyness, zu einer Zeit, in der Selbstbefreiung noch nicht auf den Begriff Sexismus gebracht wurde.

Mary Quants Mode spielt mit Geschlechterstereotypen.
Zugleich stellte diese Mode nicht nur Klassen-, sondern auch Geschlechterzuschreibungen in Frage – denn neben dem Minirock zeigte sie auch, wie Männerkleidung an Frauen wirkt. Die Hosen und Westen, die Mary Quant vorschlug, passten perfekt zu dieser Haltung.
Von der Boutique zum Label
Die Kleider waren nicht billig, auch wenn sie ab 1962 in 1000er Serien gefertigt wurden. Die Fertigung vor Ort war sorgfältig, Details wie angenähte Kragen, Reissverschlüsse, spezielle Knöpfe, angeschnittene Ärmel oder Absteppnähte brauchten mehrere Produktionsschritte. Die Kollektionen wirkten auffallend und poppig, aber in der Machart nie billig. 1963 kostete ein Schürzenkleid sechs Guineas, was heute rund 100 Pfund sind. Wer nicht so viel Geld aufbringen konnte, griff sich das Schnittmuster und nähte selber nach.

Mary Quant wählt Stoffe aus, 1967 © Rolls Press/Popperfoto/Getty Images
Bald goss Mary Quant ihre Auffassung einer jungen, tragbaren, unkomplizierten Mode in das, was wir heute als Street Fashion Label kennen. Sie nahm vorweg, dass auch Konfektions-Mode weit mehr als Kleidung ist, sondern Ausdruck eines umfassenden Lebensstils. Dazu gehörten Accessoires, Unterwäsche, Strumpfwaren und Schuhe, aber auch das Make-up. In einem Dokumentarfilm erzählt sie, dass sie, die stets mit einem streng geschnittenen Bob auftrat, nicht nur die Kleider, sondern auch das Aussehen ihrer Kundinnen bestimmen wollte. Für die Make-up Linie entwarf sie ein Produktdesign, das bald weltweit bekannt war.

Accessoires gehörten bald auch zum Label Mary Quant
Sie selber trat dabei stets als ihre beste Markenbotschaterin auf. Die Fotografien von ihr, ihrer Boutique, dem Make-up-Doppeldeckerbus von 1971 und von ihren Kundinnen stehen für die Swinging Sixties. Für die Schau gewährte die inzwischen 85-jährige Dame Mary Quant den beiden Ausstellungsmacherinnen unlimitierten Zugang zu ihrem Archiv. Die Freude, dieses Archiv zu erforschen, aber auch die Wirkungen und Nachwirkungen des Labels zu erkunden, spürt man in der Ausstellung: viele Besucherinnen beginnen, über ihre eigenen Mary-Quant-Momente zu sprechen.
Victoria & Albert Museum, London
Christian Dior, Designer of Dreams, kuratiert von Oriole Cullen (V&A, London), basierend auf Christian Dior: Couturier du Rêve (Musée des Arts Decoratifs, Paris), kuratiert von Olivier Gabet und Florence Mϋller
Szenografie: Nathalie Crinière
mit begleitendem Katalog
bis 1. September (ausgebucht)
Mary Quant, kuratiert von Jenny Lister und Stephanie Wood
Szenografie: V&A
mit begleitendem Katalog
bis 16. Februar 2020