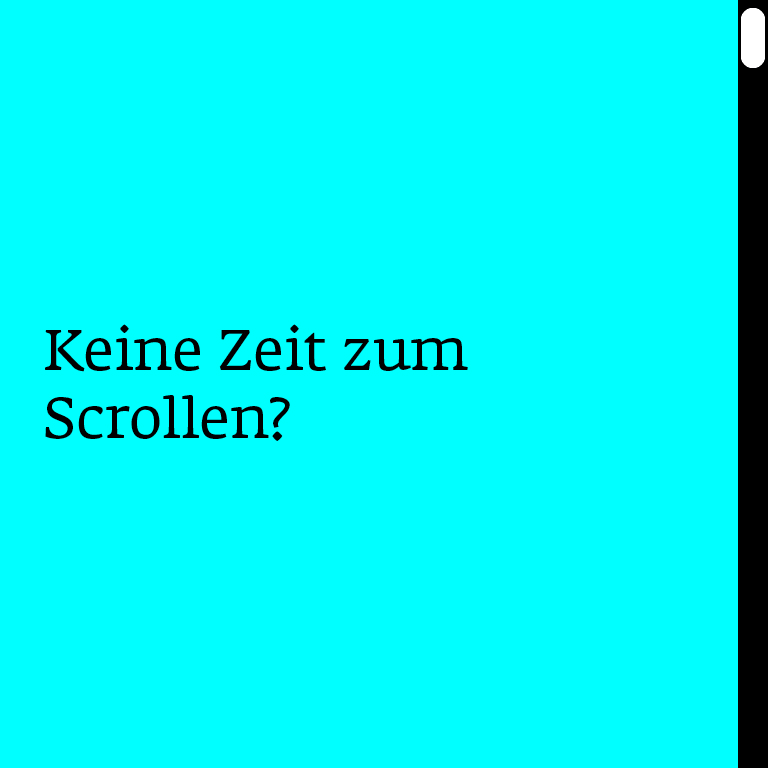Konservativ progressiv
Bern heisst sowohl Beamtenstadt als auch Landwirtschaftskanton. Wie Designerinnen und Designer leben und arbeiten, wenn die Kreativwirtschaft nicht zuvorderst steht.
26 Prozent weniger Autos fahren in Bern durch das Quartier Länggasse, seit der Neufeldtunnel den Verkehr umleitet. Diese beruhigte Situation verändert seit zehn Jahren die Nachbarschaft. Heute zählt das einstige Industrie- und Gewerbeviertel zu den begehrtesten Wohnadressen der Stadt. Die Länggasse ist hip, hier entstand die Gelateria di Berna, für die mittlerweile sogar Menschen am Idaplatz in Zürich unverhältnismässig lang Schlange stehen.
Affolter Savolainen: Design- und Literaturpreis
Die ‹Sattelkammer› an der Ecke Zähringerstrasse / Seidenweg ist ein Off-Space im Länggassquartier. Dreissig Jahre lang verkaufte dort ein gleichnamiger Laden alles für den Pferdesport. Heute gibt es anstelle von Sätteln, Gerten und Stiefeln zwei Schaufenster für Kunst und Kultur sowie vier Atelierräume. Nachdem das Lokal zwei Jahre leer gestanden hatte, übernahmen 2014 elf Künstler und Grafikerinnen die Räumlichkeiten, schlossen sich zu einem Verein zusammen und renovierten die Räume in Eigenregie, unterstützt von 11 100 Franken, die sie mittels Crowdfunding generierten. Heute wird der Ausstellungsraum von einem Künstlerkollektiv bespielt und von der Stadt Bern, der Burgergemeinde, aber auch national von Pro Helvetia unterstützt.
Im zweiten Schaufenster am Seidenweg arbeitet das Grafikkollektiv Affolter Savolainen. Sabine Affolter und Patrick Savolainen gestalten seit sieben Jahren gemeinsam, Luzia Wantz stiess vor drei Jahren dazu. Alle drei haben an der Hochschule der Künste Bern (HKB) Kommunikationsdesign studiert. Auf dem Tisch vor ihnen steht frisch gebrauter Kaffee, «geröstet in Bern», sagt Sabine Affolter. Ihr Kollektiv funktioniert lose, alle drei agieren als Einzelfirma. Mal bearbeiten sie Projekte gemeinsam, dann wieder selbstständig. Nebst der Grafik verfolgen alle eine eigene Passion: Luzia zeichnet, Patrick schreibt, Sabine fotografiert. Mit ihrer Bildstärke gewann Letztere vor vier Jahren die Kategorie ‹Research› des ‹Design Preis Schweiz›.

Ihre ‹Dolografie› visualisiert Schmerz in 34 Bildern. «Als Kartenset aufbereitet unterstützen sie Patientinnen und Patienten in der Therapie, ihren Schmerz zu beschreiben.» Seit dem Preisgewinn arbeitet die Grafikerin daran weiter. Gerade entwickelt sie mit einer Dozentin der Fachhochschule Gesundheit in Zürich eine Schulung, die Spitalpersonal vermittelt, wie sie die Schmerzbilder in ihre Arbeit auf der Station einbauen.

In ihrer Arbeit will das Kollektiv «gemeinsam mit den Kunden die Tonhöhe finden, die es für das jeweilige Projekt braucht», sagt Luzia Wantz. Im Moment entwerfen sie das Erscheinungsbild für eine Sexologin: «Wir begleiten gerne Projekte, in denen wir eine inhaltliche und soziale Dringlichkeit sehen», meint Sabine Affolter. Patrick Savolainen wohnt seit zwei Jahren auch in Schweden, ab und zu unterrichtet er als Gastdozent an der Schule für Gestaltung in Biel. Gemeinsame Arbeiten diskutieren die drei seither häufig via Internettelefonie. Sie schätzen den Austausch: «Der frische Blick des Gegenübers auf die eigene Arbeit verbessert diese», sagt Wantz. Savolainen arbeitet nicht nur als Grafiker, sondern ist auch Schriftsteller. Sein Roman ‹Farantheiner› ist soeben mit dem Schweizerischen Literaturpreis ausgezeichnet worden. Savolainen absolvierte an der HKB einen doppelten Bachelor, studierte Grafikdesign in Bern und parallel dazu literarisches Schreiben in Biel.

Seit er auch in Schweden lebt, vermisst er, was ihn an Bern ärgert und umgekehrt: «In Stockholm fehlen mir meine Freunde und die Kompaktheit der Stadt. Bin ich zurück in Bern, wünsche ich mir mehr Zeit für mich.» Beide Städte seien Freilichtmuseen, «die Altstadt ist omnipräsent». Einmalig seien in Bern die Förderinstrumente: «Durch die Design-Stiftung wird Design auch auf lokaler Ebene gefördert», sagt Savolainen. Luzia Wantz und Sabine Affolter wiederum loben Bern als unaufgeregt, ehrlich – aber träge. Wantz interessieren die Ränder der Stadt: «Bümpliz oder Ostermundigen mit dem einstigen PTT-Turm inspirieren.» Auch die Nähe zu Biel mag sie. Savolainen pflichtet bei: «Dort sehe ich an Häusern Schriften, die es sonst nirgendwo mehr gibt.» Da Bern keine grosse Stadt sei, entstünde Austausch oft über einzelne Disziplinen hinweg und punktuell – eher, als dass sich eine spezifische Grafikszene herausbilde und institutionalisiere. «Ich interessiere mich für Menschen und ihre Projekte und weniger für Apéros», sagt Affolter.
Hochschule der Künste Bern: «Design mit Inhalt»
Die HKB, an der die drei studiert haben, liegt fünf Minuten vom Bahnhof Bümpliz Nord an der Fellerstrasse 11. Südlich ragen die brutalistischen Türme der Tscharnergut-Siedlung in die Höhe. Der zweigeschossige Skelettbau stammt aus dem Jahr 1958, entworfen und berechnet wurde er vom Architekten Henry Daxelhofer und dem Ingenieurbüro Emch + Berger. Auftraggeberin war die Modefirma Schild, deren Produktion im Mattequartier zu klein geworden war. Die paar letzten Schild-Outlets, die es noch gibt, werden im Laufe dieses Jahres verschwinden – genäht werden die Kleider schon lange nicht mehr in Bern.
In der luftigen Shedhalle der früheren Textilfabrik mischen sich Stimmen und Gelächter mit geschäftigen Schritten. Der Arbeitsplatz von Robert Lzicar liegt zuoberst unter dem Sägezahndach, durch eine Scheibe blickt er auf die Arbeitsplätze seiner 35 Studentinnen und Studenten. Seit vier Jahren leitet er den Design-Master, der auf zwei Vertiefungen basiert: ‹Entrepreneurship› und ‹Research›. Wer sich für ‹Entrepreneurship› entscheidet, entwickelt ein unternehmerisches Konzept für ein Produkt oder eine Dienstleitung. Studierende in ‹Research› schliessen mit einem Plan für ein Forschungsprojekt ab.
«Viele unserer Studierenden arbeiten heute irgendwo dazwischen», sagt Lzicar. «Indem sie forschende und unternehmerische Kompetenzen kombinieren, besetzen sie Positionen ausserhalb der traditionellen Berufsfelder.» Der HKB-Master verlangt nach Projekten mit hoher gesellschaftlicher Relevanz. «Wir wollen Designerinnen und Designer unterstützen, das Potenzial ihrer Ideen kritisch zu hinterfragen.» Ein Student etwa bewarb sich ursprünglich mit einer Plattform für Rock und Pop – während des Studiums und weiteren Recherchen wurde aus der Idee ein Onlineprojekt für nachhaltigen und fairen Kaffeehandel. Nun vermittelt er online grüne Kaffeebohnen direkt vom Bauern und umgeht Zwischenhändler. Das suchten die Bewerberinnen und Bewerber in Bern: «Design mit Inhalt».
Weiter verspricht der Master Internationalität, die Dozierenden unterrichten in Englisch. Tatsächlich kommen die Studentinnen und Studenten aus Japan, Pakistan oder Taiwan, nur ein gutes Drittel stammt aus der Schweiz. Ein Problem aber hat die Berner Schule: Nach ihrem Abschluss bleiben die Alumni kaum in der Stadt. Warum das so ist? «Die Szene ist klein und leise», sagt Robert Lzicar, der in Zürich lebt. Er habe oft das Gefühl, Bernerinnen und Berner tränken lieber ein Feierabendbier, anstatt eine Talkrunde zu besuchen. Hier gehe halt tatsächlich alles einen Takt langsamer, er lernte dieses «erst einmal Abwarten» schätzen. Dennoch findet Lzicar: «Bern verkauft sich oft unter Wert.» Gerade die Nähe zur Verwaltung berge für Designerinnen und Designer Möglichkeiten. Er beabsichtigt, entsprechende Kontakte zu stärken, und wünscht sich fürs Design in der Stadt mehr Sichtbarkeit.
Ein Schritt in diese Richtung markiert die Designinitiative Bern, mit der die Masterausbildung der HKB, die Berner Design-Stiftung sowie Creative Hub und Impact Hub die Kreativwirtschaft in und um Bern fördern wollen. Neu ist das Programm ‹DEAL›, das einen Arbeitsplatz und Coachings vor Ort bietet, um die Alumni in der Stadt zu halten. Es erinnert an den Genfer ‹AHEAD Design Incubator› (siehe Hochparterre 9 / 18), den die Westschweizer Hochschule seit zehn Jahren erfolgreich betreibt.

NCCFN: Die künstlerische Freiheit, keine Mode zu machen
Zurück im Zentrum, im Lorrainequartier. Am Centralweg will die Stadt schon seit Jahren bauen, doch Anwohner blockieren das Projekt ‹Baumzimmer›, weil sie zu hohe Mieten und damit Gentrifizierung befürchten. Nun hat die städtische Immobilienabteilung die Pläne überarbeitet und verspricht günstigen Wohnraum. Ursprünglich war auch die direkt an die Liegenschaft angrenzende Parzelle des Lagerwegs 12 für das Projekt vorgesehen. Doch das Reihenhaus, ein ehemaliges Bordell, ist seit sechs Jahren besetzt. Die Besetzerszene ist in Bern stärker als in anderen Schweizer Städten. Am Lagerweg geht es aber nicht um Wohnraum – da ist die autonome Schule ‹Denk:Mal› aktiv, die von der Stadt mit dem Integrationspreis ausgezeichnet wurde. Am Anschlagbrett vor der Haustüre findet sich der Stundenplan: Farbige Zettel kündigen Thaiboxen, Hula-Hoop oder Berndeutschkurse an. Zudem sind im Haus Werkräume untergebracht.

Nina Jaun öffnet die Haustüre und führt, vorbei an einem Gratisladen mit vier Sofas und einer Kiste Brot, ins Untergeschoss. Hinter dem Boxkeller liegt ihr Atelier, in dem sie seit drei Jahren arbeitet. Letzten Winter hat sie ihr Modedesignstudium in Basel abgeschlossen. Ihre Kollektion ‹19.90› kritisiert die immer schnelleren Zyklen der Modeindustrie und verarbeitet Überproduktion zu neuen Kleidern. Dabei verwendet sie etwa Stücke aus der Konkursmasse von Switcher.

Ihr Label NCCFN steht für ‹Nothing can come from nothing› und parodiert kapitalistische Mechanismen. «Der Name könnte ebenso gut für ein Zugunternehmen stehen – null Bedeutung, dafür umso mehr Inhalt», sagt Nina Jaun lachend. Sie versteht ihre Disziplin erfrischend offen, erarbeitet ihre Entwürfe mit Grafikdesignern, Handwerkerinnen, Kunst- und Kulturschaffenden. NCCFN funktioniert als Kollektiv: «Wir wollen unsere Ideen im Bereich Mode gemeinsam erarbeiten und kommunizieren», sagt Jaun, während zwei ihrer Kollegen durchs Hinterhoffenster zu ihr ins Atelier steigen. Pino Güntensperger gestaltet die NCCFN-Schriftzüge, Thibaud Balsiger ist Schreiner und leitet das Siebdruckatelier in der alternativen Werkstatt Viktoria. Er druckt für das Label.
Nina Jauns systemkritische Haltung erwachte während ihrer Lehre zur Bekleidungsgestalterin: «Zum einen fragte ich mich, woher die Textilien stammten, die ich verarbeite», sagt sie. Zum andern hat sie als Schneiderin in einer Fabrik oder als Verkäuferin bei H & M gearbeitet und unterschiedliche Rollen der textilen Kette kennengelernt: «Ich wurde dort geringschätzig behandelt.» Auch die Entwurfsarbeit in der Schule prägte sie. Um Schnitte auszuprobieren, holten die Studentinnen und Studenten Kleider aus dem nahen Brocki, die sie umarbeiteten und dann in neuem Stoff nachbauten. «Das erschien mir seltsam – alles war schon doppelt und dreifach da.» Richtig die Augen geöffnet habe ihr aber die Arbeit bei Jahnkoy in New York: «Naiv wie ich war, erschrak ich über die schnelllebige Realität der Branche.» Zwar arbeitet auch Jahnkoy an Kollektionen mit sozialkritischem Unterton. «Wenn die Stücke dann aber bei Bergdorf Goodman neben Chanel und Prada hängen und tausend Dollar kosten, haben sie für mich ihr Ziel verfehlt», sagt Jaun. Ihr und ihren Kolleginnen und Kollegen geht es nicht darum, die Modeindustrie umzustürzen. «Wir haben uns bewusst eine kontroverse Position im System Mode geschaffen», erklärt sie. Immer wieder beschäftigen sie die Begriffe ‹exklusiv› und ‹inklusiv›. «Wir möchten allen Leuten ermöglichen, unsere Mode zu tragen», sagt Thibaud Balsiger. So fahren sie mit einer mobilen Siebdruckwerkstatt in Quartiere, wo alle ihre eigenen Kleider mit dem NCCFN-Logo bedrucken können. «Wir setzen auf punktuelle, temporäre Präsentationen, schliessen aber klassische Modenschauen nicht aus», sagt Jaun. Schliesslich sei das der Ort, an dem die Mechanismen der Mode ausgespielt werden. Nina Jaun lacht, wenn Kleider einzig als Produkt verstanden werden. Ihr Selbstverständnis liegt näher an dem einer Künstlerin. Dennoch besucht sie im Rahmen des Programms ‹Swiss Cultural Entrepreneurship› der FHNW in Basel gemeinsam mit Pino Güntensperger einen Kurs zu Unternehmertum. «Wir lernen einiges», sagt er. Etwa, in acht Minuten das eigene Businessmodell zu beschreiben. Solche Möglichkeiten wahrzunehmen und die Wirtschaftswelt mit der ihren zu verknüpfen, mache ihre Arbeit interessant: «Wir denken durchaus gewinnorientiert – für uns bedeutet Gewinn einfach etwas anderes als Geld.»
Die Dreiheit aus Mode, Politik und Kunst begünstige die Szene in Bern. Erst in New York hätte sie realisiert, wie fortschrittlich ihre Heimatstadt sei, erzählt Nina Jaun: «Es gibt Freiräume und besetzte Häuser, so etwas ist in New York nicht mehr denkbar.» Fragwürdig findet sie die Koordinationsstelle Zwischennutzung der Stadt, die seit drei Jahren existiert. Tatsächlich stösst diese nicht nur in ihrer Szene auf Skepsis. Sie sei unnötig, meint die FDP, denn Zwischennutzer und Eigentümer von leer stehenden Liegenschaften hätten sich schon früher gefunden. Von Seite der Grünen heisst es, die Stelle gestalte den Austausch mit den Besetzern zu wenig aktiv. Die Kritik seitens NCCFN ist knapp: «Einmal mehr steht der Gewinn im Vordergrund», meint Pino Güntensperger.
Berner Design-Stiftung: Fördern seit 150 Jahren
Nächster Halt: Berner Generationenhaus beim Bahnhof Bern. Das hauseigene Café ist voll besetzt, an einem Tisch jassen vier ältere Frauen, am nächsten unterrichtet eine junge Frau Deutsch. Meret Mangold sitzt in der Mitte des Raums. Seit 19 Jahren leitet sie die Geschäfte der Berner Design-Stiftung. «Wir schaffen einen Dreiklang aus Fördern, Vermitteln und Sammeln von Design im Kanton Bern – mit nationaler Ausstrahlung», sagt sie. Zur Verfügung stehen jährlich 330 000 Franken, in die Förderung gehen 90 000 Franken.
Weil sie vor zehn Jahren feststellte, dass Beiträge für die Kreativwirtschaft fehlten, richtete die Stiftung eine Kategorie ein, um die Vermarktung von Produkten zu unterstützen. Die Erfahrungen sind gut: «Es variiert, aber über die Jahre hinweg halten sich die Eingaben für Marketing und Produktion die Waage», sagt Mangold. Ihr oberstes Ziel ist es, die Öffentlichkeit für das Thema Design zu sensibilisieren – aber auch politische Behörden und die Wirtschaft: «Der Kanton Bern ist von der Landwirtschaft geprägt, es gibt vergleichsweise wenig Industrie.» Deshalb sei auch der Begriff Kreativwirtschaft weniger weit entwickelt als andernorts.
Und wie sieht das in der Stadt aus? Ein Postulat der SP forderte vor drei Jahren eine genaue Analyse zur Wertschöpfung der Stadtberner Kreativwirtschaft. Der Gemeinderat lehnte dies ab. Er erachtet sie zwar als einen wichtigen volkswirtschaftlichen Bereich, der wohl statistisch unbefriedigend erfasst und mehr als Kultur- denn als Wirtschaftsbereich wahrgenommen werde – dennoch reichten die Erkenntnisse anderer Städte aus und liessen sich auf Bern übertragen.
Die Stadt engagiert sich bisher kaum für Design oder die Kreativwirtschaft. Die ‹Kulturstrategie 2017–2028› bemängelt, dass «Bern nicht als urbaner, moderner, vielfältiger und innovativer Kulturraum wahrgenommen» werde. Zum Handlungsfeld ‹Kulturproduktion› heisst es als Zielvorgabe: «Das Bewusstsein für die Berner Kultur- und Kreativwirtschaft ist in der Politik, der Verwaltung, den Medien, der Öffentlichkeit und der Wirtschaft geschärft. Es bestehen gute Standortbedingungen und eine angemessene Förderung.» Wie genau dieses Ziel erreicht werden soll, ist noch nicht bekannt, eine Koordination mit bestehenden Instrumenten ist beabsichtigt. Seit Anfang Februar leitet Franziska Burkhardt, die einstige Chefin des Kulturzentrums Progr, das Stadtberner Kulturamt. Mit ihr steht Meret Mangold bereits in gutem Kontakt. Sie hofft auf weitere Kooperation: «Gerade Beiträge zur Vermarktung wären Sache der Wirtschaftsförderung – kantonal wie städtisch», sagt sie. So, wie es etwa in Luzern der Fall ist (siehe Hochparterre 10 / 17).
Der Kanton Bern allerdings ist einer der wenigen Kantone, die ein gut funktionierendes Fördermodell für Design entwickelt haben. Die Design-Stiftung in der heutigen Form existiert seit 1995. Damals wurde der Bereich aus Spargründen aus der kantonalen Verwaltung herausgelöst. Mit ihrer Sammlung vermittelt die Stiftung zudem einen Überblick über die angewandte Kunst: «Dieses Jahr feiern wir deren 150. Jubiläum mit einer Präsentation in der ‹Bestform›», sagt Mangold. Diese Ausstellung zeigt jeweils im April im Kornhausforum alle geförderten Projekte. Teil davon ist auch der ‹Berner Design Preis›, der dieses Jahr an SBB-Architekt Uli Huber geht siehe ‹Rückspiegel›, Seite 70.
Auch Mangold kennt das Problem, dass Geförderte weiterziehen. Warum jemand in der Stadt oder im Kanton Bern bleiben soll? «Gerade die Altstadt mit den Lauben ist attraktiv für Ladenlokale. Und mit Langenthal als Austragungsort des ‹Design Preis Schweiz› und ‹Designer’s Saturday› bietet auch der Kanton einiges.» Natürlich versuche auch sie, Kräfte zu bündeln und die Sichtbarkeit zu stärken, verweist auf die Designinitiative und empfiehlt die Stammtische des Creative Hub. Und schliesslich gebe es in Bern die Burgergemeinde. Deren 2018 geschaffene Fachstelle ‹Engagements in Kultur und Gesellschaft› berücksichtigt auch Design. Mit Patrizia Crivelli sitzt dort eine Sachverständige, die während zwanzig Jahren den Designpreis des Bundesamts für Kultur verantwortet hatte.

Florian Steiner: London nach Bern bringen
500 Meter vom Bahnhof liegt die Monbijoustrasse 6. Das Haus wurde 1906 vom Berner Architekten Eduard Rybi gebaut und ist heute als schützenswert im Bauinventar eingetragen. Bis vor Kurzem war dort das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation eingemietet, dessen Standort nach Zollikofen verlegt wurde. Heute teilen sich mehrere Jungunternehmer diese zentrale, aber teure Fläche: 360 Franken kostet der Quadratmeter jährlich. Hier arbeiten auch die Macher des Designfestivals Bern. Einer von ihnen ist Florian Steiner.
Nach einer Lehre zum Hochbauzeichner studierte er Industriedesign in Aarau und machte sich bereits während des Studiums selbstständig. Er gründete mit einem Kollegen die Firma Duotones und war dort als Kreativdirektor tätig. «Wir wollten verschiedene Schnittstellen zueinanderbringen: Interface-Design, Applikationen und Produkte», sagt Steiner. Allerdings verlangte der Markt immer häufiger nach reinem Webdesign, weshalb der Produktdesigner die Firma vor zwei Jahren verliess.

Damals hatte er gemeinsam mit einem Kollegen bereits eine neue Idee lanciert: «Ich besuchte das Designfestival in London und dachte, so etwas braucht Bern auch», erinnert sich Steiner. Mit dem Multimedia-Designer Thomas Oehrli gründete er den Verein ‹Design Festival Bern› und veranstaltete im April 2015 die erste Ausgabe im Progr. Rund dreissig Berner Grafik-, Produkt- und Interaction-Designer präsentierten ihre Arbeiten. Keine Messe oder Verkaufsausstellung, sondern Inspiration und Austausch: «Indem sich unterschiedliche Sparten unter einem Dach treffen, sollen neue Projekte und Ideen entstehen», erklärt Steiner die Absicht. Es gab Grafiken von Büro Destruct, Möbel von Keith Reiggs oder Leuchten von Daniel Ehrensperger zu sehen. «Die erste Veranstaltung fokussierte auf regionales Schaffen», erzählt Steiner, nach einer nationalen Ausgabe 2017 ist nun ein internationaler Fokus geplant. Dieses Jahr gibt es zudem mehr Inputreferate, hier setzen die Macher erstmals auch ein Thema: ‹Digital, Analog und Transition›. Ansonsten aber steht das Experiment im Vordergrund, jede Ausgabe etwas Neues. Gab es im ersten Jahr nur einen Standort, versuchten sie es im zweiten mit neun: Während dreier Tage präsentierten Designerinnen ihre Arbeiten in den Bereichen Grafik-, Produkt- und Interaction-Design überall in der Stadt, vom Kornhausforum bis ins Zentrum Paul Klee. Wurden die Macher im ersten Jahr überrannt, kalkulierten sie das zweite Mal zu optimistisch. Kombiniert mit schlechtem Wetter brach es dem Verein fast das Genick. «Dieses Jahr reduzieren wir deshalb wieder», sagt Steiner. Den biennalen Rhythmus behalten sie aber bei.
Florian Steiner arbeitet dazwischen weiterhin als Designer. Aktuell entwirft er einen Verkaufsstand für die Gelateria ‹Kalte Lust›, der im nächsten Sommer vor dem Luzerner KKL zu stehen kommt. Er arbeitet zudem gemeinsam mit der Berner Schmiede Klötzli an einer neuen Messerserie. Profitiert hat er auch von seiner Zeit in der User-Experience-Firma: Er ist Teil des Designteams des Start-ups Klara. Dieses entwickelt Software für KMUs, etwa eine Lohnbuchhaltung im Taschenformat: «Mittels Scan lassen sich Rechnungen und Belege mobil übermitteln, archivieren und automatisch verbuchen.»
Steiner bezeichnet Bern als grosses Dorf. Will er sich inspirieren lassen, fährt er weiterhin nach London. «Es könnte schon mehr passieren», meint er. Zwar schätzt er Initiativen wie den Impact Hub, die Stadt selbst aber engagiere sich nach wie vor in erster Linie für Kunst, was er bedauert: «Design wird spärlich gefördert.» Umso wichtiger ist für ihn die kantonale Förderung, «die Berner Design-Stiftung unterstützt uns seit der ersten Ausgabe – und auch die Burgergemeinde». Für seine persönliche Arbeit ist ihm die Bürogemeinschaft für den Austausch wichtig, für sein nationales Netzwerk setzt er auf den Berufsverband Swiss Design Association. Die Nähe zu den Alpen schliesslich macht ihm ein aussergewöhnliches Hobby möglich: Er gestaltet Schnee – seit zehn Jahren nimmt er jährlich am World Snow Festival in Grindelwald teil, wo die besten Schneeskulpturen prämiert werden.

Sabina Brägger: Stör, Bison und Murmeltier
Die letzte Station führt raus aufs Land nach Oberbottigen, ins westlichste Quartier der Stadt. Wer am Bahnhof Riedbach aussteigt und die Bottigenstrasse entlanggeht, steht mitten in den Fünfzigerjahren. An der Nummer 379 liegt die Sattlerei Aeberhard. Hier arbeitet die Textildesignerin Sabina Brägger. Im ehemaligen Ladenlokal hat sie ihr Atelier eingerichtet, einen Raum weiter stanzen und nähen noch immer zwei Sattler. Für ihren Bachelorabschluss in Luzern suchte Brägger vor fünf Jahren ein passendes Thema, Fragen zur Nachhaltigkeit trieben sie um. Ihre Mutter hatte gerade die Störzucht im Tropenhaus Frutigen besichtigt und gelernt, dass dort mehr als 800 Kilogramm Kaviar gewonnen, das Fischfleisch verkauft, die Häute aber verbrannt werden. «Mein Thema», erkannte Brägger. Sie hatte bereits mit Restleder gearbeitet und kleinste Stücke zu neuen Flächen zusammengesetzt. Diese Technik nun mit den nicht mehr gebrauchten Fischhäuten zu kombinieren, lag auf der Hand.

Sabina Brägger nutzte ihren Bachelor um herauszufinden, wie sie das harte Fischleder natürlich gerben und verarbeiten kann – die Störhaut ist mittig von harten Muschelschuppen bedeckt, die gegerbt an Krokodilhaut erinnern. Aus dem aufbereiteten Leder fertigt die Textildesignerin heute Souvenirs für den Shop des Tropenhauses oder Armbänder für die Uhrenmanufaktur ‹Ochs und Junior› und hat eine eigene Accessoire-Kollektion aus Taschen, Gürteln und Portemonnaies geschaffen.
Das Business mit dem Fischleder verfolgte sie parallel zu ihrem Masterstudium in Luzern. Weil sie nicht für immer Frau Stör sein wollte, entwickelte sie die Idee, weitere Restmaterialien aufzuspüren. Das neue Projekt: Bisonwolle. Auch in der Schweiz werden die Tiere gehalten, aber nur ihr Fleisch wird genutzt. Die Haut verarbeiten die Halter vereinzelt zu Leder, doch das Fell werfen sie weg. «Obwohl es sehr warm ist und dennoch leicht», sagt Brägger. In ihrem Master hat sie untersucht, wie die Fasern aufgebaut sind und wie sie diese verarbeiten kann. Sie ist über die Weiden gestapft, hat Schlachtereien besucht und Bisonwolle gesammelt, um diese zu filzen, spinnen, verweben oder stricken. Anders als beim Störleder will Brägger nun ein Halbfabrikat verkaufen und spielt so ihre Kompetenz als Textildesignerin aus. ‹Bison – Premium Wool Swissmade› nennt sie ihr Produkt. «Es gibt noch nichts Ähnliches auf dem Markt. Produzenten aus dem Textilverband haben Interesse signalisiert.» Aktuell bekommt sie allerdings noch zu wenig Wolle zusammen – scheren lassen sich die riesigen Tiere nicht, und Totschur bringt zu wenig Material. So entwickelt sie mit einem Maschinenbauer einen Kratzbaum für Bisons, den sie via einen Landmaschinenhersteller vertreiben möchte.
Zwar arbeitet Sabina Brägger auf Stadtberner Boden, dennoch ist sie ausserhalb der Stadt: «Das hat Vor- und Nachteile», sagt die Textildesignerin. Sie schätzt die Natur – vermisst aber den Kontakt zu anderen Designern und Gewerken, auch wenn sie in sechs Minuten am Bahnhof ist. Bern sei halt eine Beamtenstadt: «Ein Sattleratelier mit den nötigen Maschinen wäre in der Stadt kaum machbar gewesen.» So lebt sie nun im Breitenrain und arbeitet im Westen. Ihr Ziel ist es, über die Jahre mehr Wissen zu nicht gebrauchten Materialien aufzubauen. Sie hält Vorträge und besucht Messen. Gerade hat sie an der Berner ‹Ornaris› ausgestellt, «einer wichtigen Plattform, um Kontakte zu Facheinkäufern herzustellen». Dort hat sie einen Hersteller von Murmeltiersalbe kennengelernt. «Sie erlegen 5000 Murmeli jährlich, diese Häute könnten etwas hergeben», sagt Sabina Brägger aufgeregt. Ein erstes Treffen hat bereits stattgefunden.
Dieser Beitrag stammt aus der Ausgabe 4/2019 der Zeitschrift Hochparterre.
Kommentar: ‹Dene wos guet geit›
Das Klischee der langsamen Berner ist bemühend – umso erstaunlicher, wenn es die jungen Designerinnen und Designer in ihren Aussagen zementieren. Stadtpersönlichkeit? Sagengestalt Dietrich von Bern, Herzog Berthold von Zähringen, Stadtgründer Adrian von Bubenberg – eine rückwärtsgewandte Sicht, die bis ins zwölfte Jahrhundert reicht. Hinzu kommen grosszügige Fördergelder und eine im Vergleich mit anderen Schweizer Städten noch komfortable Wohnsituation, die bei den Bernern aber schon kritisch begutachtet wird. «Klagen auf hohem Niveau», ist die Autorin versucht zu sagen. «Undankbar und verwöhnt», wäre das harte Urteil. Nach all den bunten Begegnungen, den vielen wunderbaren Ecken und dem Eintauchen in eine warme Stadt, ist die Erkenntnis aber eine komplett andere: Es lohnt sich, für Werte einzustehen und für etwas zu kämpfen. Wenn in der Stadt Bern gegenüber Lausanne, Genf und Zürich nach wie vor günstiger Wohnraum verfügbar ist, hat sich offenbar jemand erfolgreich gewehrt. Bedeutet der Preis dafür nun Trägheit – warum nicht? Konservativ ist das neue progressiv, heisst es.
Design zum Feierabend
‹Gern in Bern: Wie gelingt es, Designschaffende in der Stadt zu halten?› Hochparterre lädt ein zur Diskussion mit Apéro und Austausch. Meret Mangold, Geschäftsleiterin Berner Design-Stiftung, begrüsst, und es diskutieren Minou Afzali, Master Design HKB, Jérôme Rütsche, Industriedesigner ‹Crisp›, Virce Resta, Standortförderung Kanton Bern, und Paula Sansano, Architektin und Initiantin ‹Affspace›. Moderation: Meret Ernst, Hochparterre.
Samstag, 27. April, 17 Uhr, in der Ausstellung ‹Bestform›, Kornhausforum, Kornhausplatz 18, Bern. Hier anmelden.