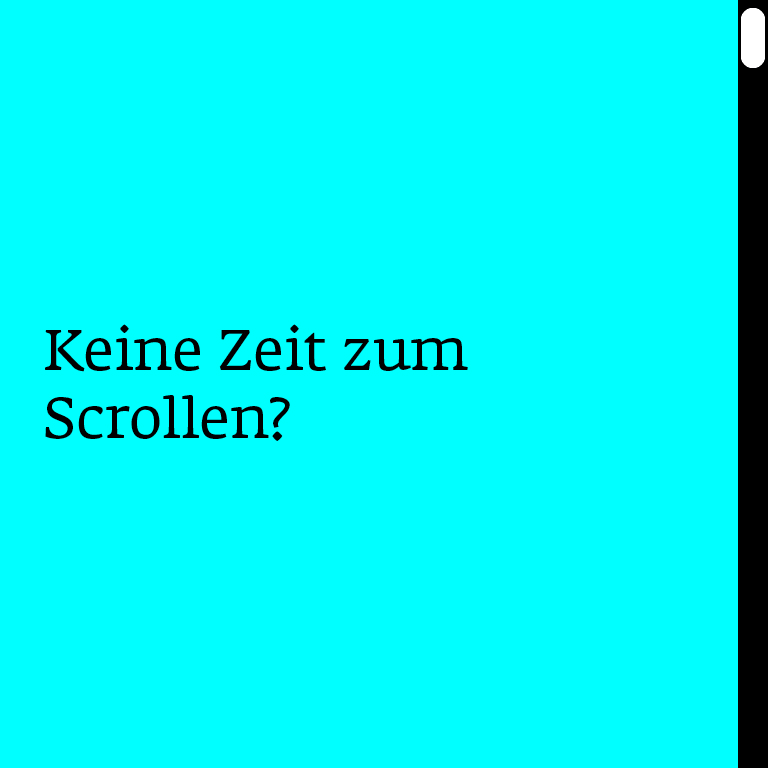Fünf Lehren von Tokio
Am Symposium «Learning from Tokyo» fragten Architekten, was Zürich von der japanischen Grossstadt lernen könnte. Fünf Schlüsse aus der angeregten Debatte.
«Learning from Tokyo» hiess das Symposium zu dem eine Gruppe um Hosoya Schaefer Architekten zusammen mit Büros aus Japan am Wochenende luden. Gleich zu Beginn konnten die Teilnehmer von der japanischen Gelassenheit lernen. Im Architekturforum Zürich war es nämlich fast so eng wie in der Tokioer Metro zur Stosszeit. Auf den dicht bepackten Saal wartete ein geballtes Programm. Junge Architekturbüros aus Japan zeigten ihre Projekte und diskutierten anschliessend mit gestandenen Schweizer Architekten wie Roger Diener, Marc Angélil oder Christian Kerez. Manchmal verfingen sich die Voten an den Sprachhürden. Teilweise schienen die Unterschiede zwischen den beiden Planungskulturen zu gross für eine fruchtbare Debatte. Zürich ist nicht Tokio. Und doch kristallisierte sich im Verlaufe der beiden Tage einiges heraus, das Zürich von Tokio abschauen könnte.
1. Dichte heisst nicht grosse Blöcke. Die Parzellen in Tokio sind klein, teilweise nur wenige Meter breit. Dennoch ist das Stadtgefüge dicht, fast jeder Quadratmeter überbaut. Statt den Passanten mit Superblöcken zu erschlagen, macht die Kleinteiligkeit die Dichte erträglich. Allerdings ist auch in Tokio seit einigen Jahren die Tendenz zu erkennen, wuchtige Überbauungen auf einen Schlag zu errichten.
2. Enge führt zu Qualität. Tokio hat keine mittelalterliche Innenstadt, doch viele Quartiere fühlen sich – abgesehen von der Architektur – genauso an: Häuser direkt am Trottoir, schmale Gassen, dicht belegter Strassenraum. Das zeigt: Für urbane Qualität braucht es keine alten Blockränder, auch ein kunterbundes Gemisch an modernen Bauten kann Stadt schaffen. Würde man also die Häuser in der Schweizer Agglo näher aneinander schieben, entstünde in der Zwischenstadt plötzlich Stadtraum.
3. Bescheidenheit schafft Raum. Die Japaner haben eine andere Beziehung zum Raum. Sie brauchen weniger Platz und nutzen ihn kreativer als Europäer. So zeigte der Architekt Riken Yamamoto einen Entwurf für eine Siedlung, die auf einem 2.4 x 2.4 x 2.6 Meter grossen Raummodul basiert. Zwei oder drei solcher Kapseln lassen sich zu einer kleinen Wohnung zusammenfügen. Der Zürcher, der auf durchschnittlich 54 Quadratmetern haust, würde hier wohl aus Platzangst die Augen rollen.
4. Keine Angst vor Nähe. In Tokio stehen die Häuser dicht an dicht. Teils sind die Bauten nur eine Armlänge voneinander entfernt. Die Enge spornt viele japanische Architekten zu neuen Lösungen an, um die Nähe zu filtern. Go Hasegawa präsentierte ein Wohnhaus, hinter dessen Fassade eine Balkonschicht die Innenräume von der Stadt isoliert. So treffen privater und öffentlicher Raum nicht direkt aufeinander. Auch in Zürich könnte so der Dichtestress entspannt werden.
5. Weniger Regeln ist mehr. In Japan gibt es zwar strikte Baugesetze, was Fluchtwege und Erdbebensicherheit anbelangt. Gestalterisch sind die Architekten aber weitgehend frei. Dies erlaubt gewagte Raumexperimente, von denen Schweizer Architekten nur träumen können. Sou Fujimoto etwa zeigte ein Wohnhaus, das aus drei ineinander gestellten Boxen besteht, oder eines, das aus einzelnen Giebelhäusern gestapelt ist. Letzteres ist bei uns Sonderbauten wie dem Vitra Haus vorenthalten. Wohnbauten aber werden gewöhnlich zum pragmatischen Kubus gedrängt.
Die Ausstellung im Architekturforum zeigt rund ein Dutzend solcher virtuoser Häuser. Sie alle sind als Einzelobjekte konzipiert, die die Stadt nicht weiterbauen, sondern für sich stehen. Doch in einer Metropole, in der gerade mal 3 Prozent der Gebäude vor 1960 gebaut wurden und die Häuser durchschnittlich 26 Jahr alt sind, finden sich nicht viele Anknüpfungspunkte. So kann Zürich von Tokio auch im negativen Lernen: Wir müssen Sorge tragen zum Bestand. Er ist ein Schatz, den Tokio fast vollständig aufgeben musste.