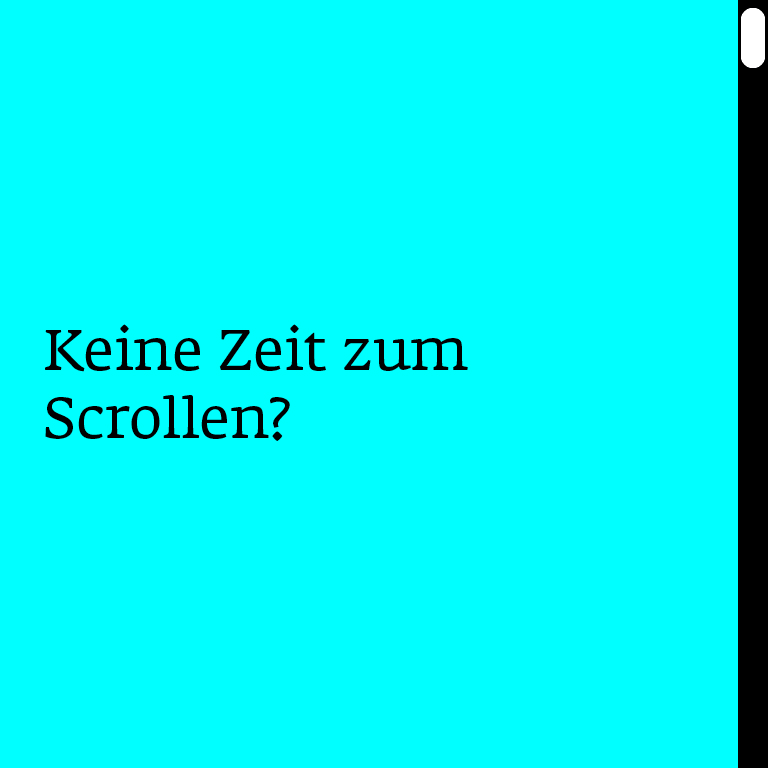534 Fragen
Ausloberinnen von Spitalwettbewerben überladen das Raumprogramm, die Anforderungen und die Jurys – mit fraglichem Nutzen. Warum es auch einfacher geht. Ein Text aus dem neuen Themenheft «Das gute Spital».
«Man sollte Freude haben an komplexen Raumprogrammen», sagt Lukas Meyer über Spitalwettbewerbe. «Hat man diese erst einmal geknackt, eröffnen sich architektonische Freiheiten.» Mit seinem Zürcher Architekturbüro Manetsch Meyer hat er bisher an fünf Wettbewerbsverfahren für Spitäler teilgenommen und bringt eine Aussage vieler Architektinnen und Architekten auf den Punkt: Im Spitalwettbewerb steckt mehr Architektur, als Aussenstehende glauben. Thomas Hasler vom Büro Staufer & Hasler Architekten in Frauenfeld schwärmt von den «vielen Schichten» der Spitalprojekte und von der Freude, «aus einem komplexen Konglomerat eine Gebäudelogik zu gewinnen». Auch Reto Gmür von Silvia Gmür Reto Gmür Architekten in Basel findet in Spitalwettbewerben genuin städtebauliche und architektonische Themen, die es in keinem anderen Genre gebe.
Eine schöne Bestätigung
Der Spitalwettbewerb wird also unterschätzt – nicht in Bezug auf Komplexität oder Aufwand, aber hinsichtlich der gestalterischen Spielräume. Oft bleibt er ein Respekt einflössender Koloss, der einem Architekturbüro alles abverlangt. Das Anfang 2019 abgeschlossene Verfahren für das Kernareal des Universitätsspitals Zürich (USZ) dauerte 18 Monate. Während dieser Zeit fanden zwei grosse Abgaben und etliche Workshops mit Auslobern und Bauherrschaft statt. Die Themen sind vielfältig: Es gilt, grosse Spitalbauten in einem stadtverträglichen Mass zu gestalten, der Anschluss an den Stadtraum gewinnt an Bedeutung, die Erschliessungssysteme müssen logisch aufgebaut sein und zugleich gute Aufenthaltsorte bieten – und überhaupt ist inzwischen bekannt, dass sich eine gute Raumstimmung positiv auf den Genesungsprozess auswirkt. Ausserdem ist es eine noble Sache, für eine gesellschaftliche Aufgabe einen Beitrag zu leisten. Immerhin geht es um Leben und Tod – und eben neuerdings auch um Qualität. Schliesslich – und auch das interessiert Architektinnen und Architekten – ist der Gesundheitssektor ein Wachstumsmarkt, in dem enorm viel gebaut wird.
Cornelius Bodmer hat mit dem Brugger Büro Metron bereits in den Achtzigerjahren an Spitalwettbewerben teilgenommen und einige gewonnen. «Als wir damit anfingen, hat sich kaum ein Architekturbüro dafür interessiert», erinnert er sich. Umso mehr freut es ihn aufrichtig, dass das Thema nicht mehr belächelt wird: «Für mich ist es eine schöne Bestätigung, dass inzwischen Büros wie Herzog & de Meuron den Spitalbau für sich entdeckt haben.» Lorenzo Giuliani vom Zürcher Büro Giuliani Hönger Architekten gehört zu jenen, die in den letzten Jahren dazugestossen sind: «Uns hat motiviert, dass ‹klassische› Architekturbüros wie Staufer & Hasler in Chur und Fawad Kazi in St. Gallen an Spitalwettbewerben teilnehmen und sie sogar gewinnen können.» Giuliani Hönger machten ein einziges Mal mit: 2013 bei der Erneuerung des Klinikums 2 des Universitätsspitals Basel. Der Sieg des Zürcher Büros löste in Basel eine Kontroverse aus, aber mittlerweile haben sich die Gemüter wieder beruhigt. Herzog & de Meuron, die mit dem zweiten Rang das Nachsehen hatten, gewannen im Frühling 2019 den Wettbewerb für einen weiteren Bau des Universitätsspitals.
Alles immer flexibel
Bevor ein Wettbewerb in die Wege geleitet und das Raumprogramm an die Architekturbüros verteilt wird, müssen sich Nutzerin und Bauherrschaft auf die Bestellung einigen. Bis Anfang der Zehnerjahre war in der Regel klar, wie das ablief: Das öffentliche Spital ging zum zuständigen Hochbauamt und ‹bestellte› dort einen Neubau gemäss seinen Wünschen. Das Hochbauamt mit seinen Baufachleuten schrieb den Wettbewerb aus und setzte das Siegerprojekt um.
Doch diese Zeiten sind vorbei. Im Zuge der seit 2012 schweizweit geltenden Spitalfinanzierung wurden fast alle öffentlichen Spitäler verselbstständigt – entweder in eine öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft, in eine Stiftung oder in eine andere Form. Die Spitäler bauen also jetzt selbst, und das kommt nicht überall gut an. Architekt Reto Gmür formuliert es diplomatisch: «Aufseiten der Spitäler ist die Bestellerkompetenz oft nicht gleich ausgebildet wie bei den Hochbauämtern.» Häufig fehle es an strategischer Weitsicht und am Know-how des Bauens. Gmür erstellt zurzeit einen Ersatzneubau für das Bürgerspital Solothurn – ein Projekt, das 2008 aus einem offenen Wettbewerb mit zwanzig Teilnehmenden und einem nachfolgenden Studienauftrag unter vier Teams hervorging. Der erste und zweite Rang waren in beiden Stufen identisch. Solothurn ist als einer der letzten Kantone herkömmlich aufgestellt: Bernhard Mäusli als Kantonsbaumeister und Vorsteher des Hochbauamts koordiniert den Prozess vom Wettbewerbsprogramm bis zur Schlüsselübergabe. Er ist sehr zufrieden: «Das Verfahren ist hervorragend gelaufen und das Resultat sensationell.»
Ein Problem im Spitalbau sind die Anforderungen an die Flexibilität. «Heute ändert sich alle fünf Jahre die Hälfte eines Spitals», sagt Cornelius Bodmer von Metron. «Nur schon während des Wettbewerbs und der Planung wird ein beträchtlicher Teil des Raumprogramms umgekrempelt.» Entscheidend ist also die Anpassungsfähigkeit des geplanten Gebäudes. Beim Neubau für das Bürgerspital Solothurn etwa galt es laut Kantonsbaumeister Mäusli, mehr als sechzig Projektänderungen aufzunehmen.
Flexibilität, Kostendruck und die Verdichtung der Spitalareale führen dazu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich von Liebgewonnenem trennen müssen: Mehrfachnutzungen der Räume vom Operationssaal bis zum Untersuchungszimmer sind heute an der Tagesordnung. Fortunat von Planta, Direktor des Kantonsspitals Uri, ist stolz auf den gerade erfolgten Baubeginn des Erweiterungsprojekts in Altdorf. Er braucht deutliche Worte: «Sofern nicht unbedingt notwendig, gibt es in Zukunft keine persönlich zugewiesenen Räume mehr. Der Chirurg teilt das Untersuchungszimmer mit der Orthopädin und die Medizinerin das Sprechzimmer mit dem Ernährungsberater.»
Im Wettbewerb für das Kernareal des USZ waren Flexibilität und Modularität entscheidend. «Wir bauen eine Infrastruktur», sagt Eugen Schröder, Direktor des Bereichs Immobilien und Mitglied der Spitaldirektion des USZ. So werden im Neubau von Christ & Gantenbein Architekten zum Beispiel Operationsplattformen oder Intensivpflegeplattformen geschaffen. «Für uns spielt es grundsätzlich keine Rolle, welche Klinik in welchem OP operiert. Das Spezifische, das benötigt wird, muss hinein- und wieder hinausgerollt werden können.» Die teure und knappe Infrastruktur soll stärker ausgenützt werden.
Diese Schnelllebigkeit, die weder der Wohnungs- noch der Schulhausbau auch nur ansatzweise aufweisen, steht im Kontrast zur Langsamkeit der Planungsprozesse, aber auch zur strategischen Weitsicht, die die Architekturbüros in den Wettbewerben vermissen. Beat Schneider vom Aarauer Büro Schneider & Schneider, gelegentlich auch Juror in Spitalwettbewerben, fordert von allen Spitälern Master- und Entwicklungsrichtpläne, nicht nur von den Universitätskliniken. «Oft sind die Baufelder zu klein und die Raumprogramme zu überladen», sagt er. «Mit einem stabilen städtebaulichen Konzept und einfachen architektonischen Regeln gewinnt man Sicherheit. In diesem Rahmen kann ein schlankes und kompetentes Team dann die flexible Infrastruktur planen.»
Kritik an den begleiteten Verfahren
Die fehlende Sicherheit und wohl auch das fehlende Vertrauen führen dazu, dass die Ausloberinnen den Wettbewerb überladen. Im Spitalbau hat das Auswüchse zur Folge: Da werden höchst detaillierte Planungen und Nachweise verlangt, obwohl sich bis zur Baueingabe – und erst recht bis zum Spatenstich – noch vieles ändern wird. Sämtliche für diese Recherche angefragten Architekturbüros schütteln den Kopf ob der Anforderungen. Lukas Meyer erinnert sich, dass im Wettbewerb für das Kantonsspital Uri zunächst zu detaillierte BIM-Modelle gefordert waren. «Unter dem Druck der Teilnehmenden des Studienauftrags hat man die Anforderungen an das Modell schliesslich zurückbuchstabiert.» Kritisiert werden auch die begleiteten Wettbewerbe und Studienaufträge mit Workshops und Präsentationen, die die Aufhebung der Anonymität mit sich bringen. Die Absicht der Auslober ist klar: Sie wollen Einfluss nehmen. Da auf diese Weise so mancher Fehler ausgeräumt werden kann, stemmen sich die Architektinnen und Architekten nicht gegen das Prinzip als solches. «Üblicherweise bin ich skeptisch gegenüber begleiteten Verfahren», sagt Lorenzo Giuliani, «aber als Juror habe ich nun schon einige Male die Vorteile gesehen, wenn während des Verfahrens noch betriebliche und stadträumliche Inputs möglich sind.» Es ist allerdings – um Paracelsus zu zitieren – immer eine Frage der Dosis.
Beim Wettbewerb für den Neubau des Felix-Platter-Spitals in Basel fanden in der zweiten Stufe drei Workshops und sieben Creditpoint-Gespräche statt, wie Bettina Müller erklärt. Sie hat für die Bauherrin das Verfahren organisiert, das aus Zeitgründen zügig verlaufen musste. «Die Workshops und Gespräche dienten ausschliesslich dazu, betriebliche und technische Fragen zu klären», betont Müller. Dabei hat sie festgestellt, dass «die Teams diesen Dialog sehr schätzten». Beat Schneider sieht das etwas anders. Mit seinem Büro hat er an einem ähnlichen Verfahren für das Kantonsspital Aarau teilgenommen: «Aarau war das Krasseste, was ich in den 22 Jahren seit der Bürogründung erlebt habe.» Kurzfristig seien die Anforderungen verschärft sowie ein externer Fachjuror aus der Jury entfernt und durch einen internen ersetzt worden. Sergio Baumann, Leiter des Departements Betrieb beim Kantonsspital Aarau, bestätigt, dass die Totalunternehmer-Ausschreibung «für alle Beteiligten» belastend gewesen sei. In der zweiten Stufe, als noch drei Teams übrig waren, fanden vier halbtägige Workshops statt. Ausserdem konnten die Teams spezifische Fragen stellen. «534 Fragen gingen bei uns ein.» Man erstellte mehr als fünfzig Themenpapiere mit Präzisierungen. Kliniken und Fachspezialisten waren von Anfang an mit eingebunden. Baumann betont, wie wertvoll diese Phase für das Spital gewesen sei: «Wir konnten während des Verfahrens unsere Ausschreibung präzisieren und optimieren.» Für die Teams jedoch kamen dadurch laufend neue Themen und Anforderungen ins Spiel. Gewonnen haben in diesem Frühjahr schliesslich Marti Gesamtleistungen, BAM Swiss und Deutschland sowie die Architekturbüros Burckhardt + Partner und Wörner Traxler Richter.
Letztlich bleiben auch Zweifel, ob die Auslober ein ohnehin favorisiertes Projekt in den Workshops nicht weiter fördern könnten. Thomas Hasler stellt die Angemessenheit solcher Verfahren generell infrage – nach dem enormen Aufwand im 18-monatigen Verfahren für das USZ, den Staufer & Hasler mit Meili Peter Architekten erbracht hat. «Die Anonymität ist ein wichtiger Faktor eines Wettbewerbs. Bei den Spitalplanungen ist es inzwischen normal, dass sie nicht mehr gewährleistet ist. Dabei zeigen Chur, St. Gallen und Altdorf, dass es auch ganz konventionell nach Wettbewerbsregeln geht.» Tatsächlich ist der Wettbewerb für den Umbau und die Erweiterung des Kantonsspitals Graubünden, den Staufer & Hasler 2008 gewonnen haben, der einzige offene anonyme Projektwettbewerb auf weiter Flur – mit einem hervorragenden Resultat.
Ein weiteres Problem, auch darin sind die Architektinnen und Architekten sich einig, können der Gesamtleistungswettbewerb oder die Totalunternehmer-Ausschreibung sein. Dabei gehe es nicht einmal um die Baukultur, sagt Cornelius Bodmer, es sei schlicht eine systemische Frage. «Das Wesen des Totalunternehmers ist auf genau definierte Aufgaben ausgelegt; so kann er unter optimalen Bedingungen einen Preis offerieren», meint Bodmer. «Der Spitalbau dagegen ist im Fluss, Änderungen gehören zum Alltag.» Hinzu kommt die Kontrolle des Planungs- und Bauprozesses, und hier schliesst sich der Kreis zu den oben genannten Hochbauämtern.
Solothurns Kantonsbaumeister Bernhard Mäusli hat sich für ein konventionelles Vorgehen entschieden und lauter Einzelverträge mit den Unternehmern abgeschlossen. «Den Einzelvertrag haben wir im Griff, den Totalunternehmer nicht», sagt er lakonisch. «Wir wollen wissen, mit wem wir es zu tun haben, deshalb haben wir jeden Vertrag ‹face to face› mit dem jeweiligen Unternehmer unterschrieben.» Solothurn ging damit einen aufwendigen Weg, doch das gute Einvernehmen sei ihm wichtig, so Mäusli.
Architektinnen und Architekten können das
Es liegt also noch einiges im Argen beim Spitalwettbewerb. Die komplexen Aufgaben und grossen Bauvolumen führen zu funktionalen und ökonomischen Verzerrungen, die den Spitälern letztlich nichts nützen. Was haben sie davon, wenn sie billig bauen, für die Nachforderungen des Totalunternehmers dann aber nochmals tief in die Tasche greifen müssen und in Betrieb und Unterhalt mit der billigen Lösung zu kämpfen haben? Auf der anderen Seite steigt das Bedürfnis nach Qualität, auch und gerade wegen der Konkurrenz der Spitäler: Zuoberst steht die Qualität der medizinischen Versorgung, dann aber kommen schon bald die Aufenthaltsqualität und die räumlichen Fragen sowie die Ausgestaltung von Fassaden, Erschliessung und Zimmern. Reto Gmür sagt: «Ambulante Patienten halten sich oft in Transiträumen auf. Deshalb sollten auch diese angenehm gestaltet und natürlich belichtet sein.»
Zu guter Letzt steigt die Sensibilität für städtebauliche Fragen auch in der Bevölkerung. Die stark wachsenden Spitäler können nicht beliebig Platz beanspruchen. Das zeigte die Auseinandersetzung um die Erneuerung des USZ, als Quartierbewohnerinnen und Quartierbewohner schon in den ersten Phasen Rücksicht forderten und erreichten, dass das USZ das Bauvolumen signifikant reduzierte. Es gibt viel zu tun für gute Architektinnen und Architekten im Spitalwettbewerb: Lasst sie machen, sie können das!
Dieser Beitrag stammt aus dem Themenheft ‹Das gute Spital› über die Sanierung und Restaurierung des Westflügels des Landesmuseums Zürich. Herausgeber Hochparterre und Wüest Partner, mit Unterstüzung von a | sh, blumergaignat, burckhardtpartner, hemmi fayet, Caretta Weidmann, IBG, Inselgruppe, metron, Kantonsspital Graubünden, Nickl & Partner, Planergemeinschaft Bürgerspital Solothurn, Schneider & Schneider, Steiner, wörner traxler richter und WR Architekten.
Spitalbau ist keine Mondlandung
Liebe Ausloberinnen und Auslober von Spitalwettbewerben, so geht das nicht: Sie können nicht maximale Flexibilität verlangen und gleichzeitig schon während des Wettbewerbs alles bis ins Detail planen wollen. Sie wissen ja selbst am besten, dass sich vom Juryentscheid bis zur Schlüsselübergabe noch vieles ändern wird – dass Bauen ein Prozess ist, erst recht bei einem Spital. Sparen Sie das Geld für einen aufwendigen Studienauftrag und eine grosse Jury und schreiben Sie einfachere Verfahren aus. Klären Sie im Vorfeld Ihre strategischen Bedürfnisse und stecken Sie auf Ihrem Areal die Baufelder ab. Dann können Sie mit einem einfachen Projektwettbewerb einsteigen, für den schlanke und schlaue Planungsteams verschiedene und bestimmt auch überraschende Vorschläge entwerfen werden. Seien Sie gewiss, dass die Teams hart arbeiten werden, um den Auftrag zu gewinnen. Sie brauchen zu diesem Zeitpunkt noch nicht jeden Fachplaner und jede Expertise. Es geht um einen grundsätzlichen Entscheid für eine Infrastruktur. Gemeinsam mit dem ausgewählten Team gehen Sie anschliessend an die Arbeit und planen und bauen Schritt für Schritt ein schönes, günstiges und zukunftsträchtiges Spital. Gutes Gelingen!
Caspar Schärer (*1973) ist Architekt und Publizist. Seit 2017 leitet er als Generalsekretär den Bund Schweizer Architekten (BSA).