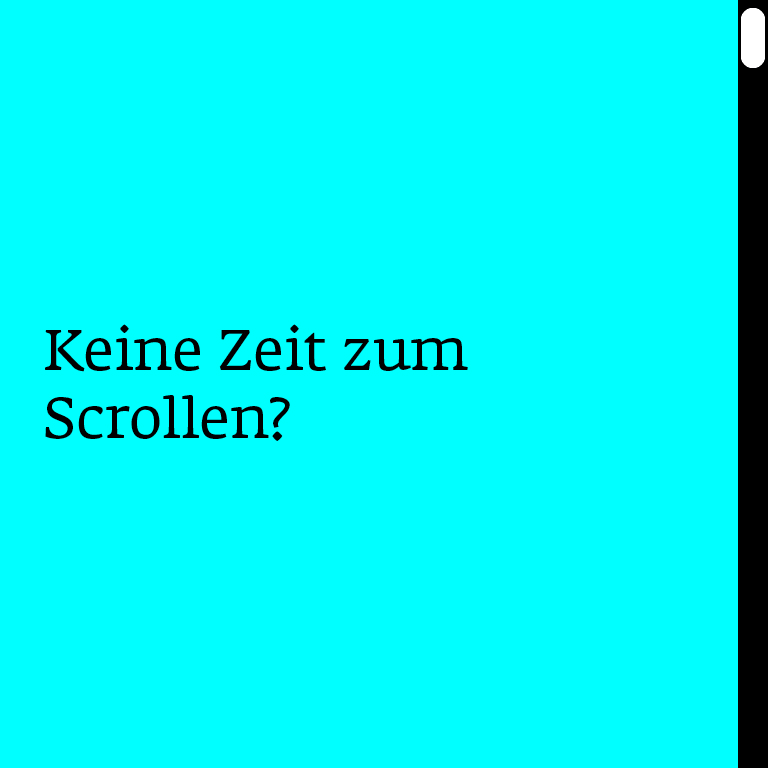«Lebenshorizont erreicht»
Viele Studentinnen und Studenten leben befristet in Liegenschaften, die vor dem Abbruch stehen und werden so Zeugen der aktuellen Stadtentwicklung.
Die ETH Zürich öffnet ihre Tore wieder im August und so lernen und arbeiten wir vorerst in unseren eigenen vier Wänden. Zuhause – für viele von uns Studierenden bedeutet dies: ein Zimmer in einer Zwischennutzung. Wir wohnen an Orten mit klingenden Namen wie Seebahnkolonie, Erismannhof, Überbauung am Salzweg, Siedlung Wydäckerring oder Brahmshof. Wir leben befristet in Liegenschaften, die kurz vor der Sanierung oder dem Abbruch stehen, und werden damit Zeugen der aktuellen Stadtentwicklung. Mit der Zwischennutzung beginnt die letzte Lebensphase eines Gebäudes, in der wir uns weit unter der üblichen Marktmiete ausbreiten dürfen. Das Jugendwohnnetz Zürich beispielsweise bietet fast 4’000 jungen Menschen in Ausbildung vorübergehend ein Zuhause. In unserer Studienzeit lernen wir so immer wieder neue Gebäude und Wohnungstypen kennen. Ob Gründerzeitblock, Gartenstadtzeile oder Boomer-Siedlung, mit oder ohne Wohnzimmer, grosse oder kleine Küche, mit Kinderzimmer, Durchgangszimmer, Balkon oder Dachterrasse. In einigen ist es im Winter kalt, in anderen im Sommer zu warm.
Wir haben gelernt, mit den Eigenheiten der Wohnungen umzugehen. Und wir bemerken dabei erstaunt, wie gut es sich an diesen Orten leben lässt – ihren angeblich veralteten Grundrissen oder der Ringhörigkeit zum Trotz. So etwas wie ein zeitgemässer Grundriss ist wohl ein Mythos: Jede Wohnung kann angeeignet werden, mit all ihren Vor- und Nachteilen.
In der Stadt Zürich wird so viel abgerissen wie schon lange nicht mehr, das bestätigen die Statistiken. Grosse Teile der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gebauten Gartenstadt wurden in den letzten zwei Dekaden aufgrund ihres hohen Verdichtungspotenzials ersetzt. Mittlerweile stehen jedoch weitaus jüngere Stadtstücke zum Abriss bereit, trotz ihrer akzeptablen Dichte. Obwohl die bestehende Realität eine vielversprechende Ausgangslage fürs Weiterbauen darstellt, wird weiterhin auf die gängige Praxis des Ersatzneubaus gesetzt. Das Ziel, mehr Menschen Wohnraum zu bieten, verläuft sich meist im Ausbau von Wohnstandards, steigenden Mieten und mehr Fläche pro Kopf. Die Strategie des Ersatzneubaus offenbart die komplexen Umstände der Stadtentwicklung: die fehlende Kultur der Substanzerhaltung, die Alternativlosigkeit am Anlagemarkt, der politische Wille zur inneren Verdichtung, und der gesellschaftliche Wunsch nach ressourcenschonenden Bauten. Der Brunaupark ist wohl das aktuell prominenteste Beispiel, das dieses Zusammenspiel der Kräfte ad absurdum führt und damit den Ersatz von 25-jährigen Gebäuden in tadellosem Zustand bewirkt.
In den nächsten Monaten und Jahren werden sich viele weitere, teils architektonisch ambitionierte Projekte dem gleichen Schicksal fügen müssen. Vor kurzem hat die Stadt Zürich einen Wettbewerb ausgeschrieben, um die Überbauung am Salzweg vom Architekten Manuel Pauli zu ersetzen. Auch die Siedlung Wydäckerring von Kuhn + Stahel Architekten wird bald abgerissen. Viele dieser Gebäude sind in der Hochkonjunktur ab Mitte der 1960er Jahre entstanden. Die damalige Dynamik ist durchaus mit der heutigen Verdichtung zu vergleichen: Grossmassstäbliche Neubauten auf Stadtgrund ersetzten den sanierungsbedürftigen Bestand. Die Reaktion auf die grenzenlosen Wachstumsphantasien liess damals nicht lange auf sich warten: «Bauen als Umweltzerstörung» proklamierte der Zürcher Architekt Rolf Keller in seinem 1973 veröffentlichten Buch, und kritisierte die investitionsgetriebene Entwicklung der gebauten Umwelt. Die grossen Siedlungen, denen Kellers Kritik damals galt, sind heute unsere Ausgangslage. Und auch wir sind desillusioniert, wenn sie erneut einer von Ökonomie und Bauregeln getriebenen Banalität Platz machen müssen. «Die Anlage hat ihren Lebenshorizont erreicht» steht dann jeweils in den Rückbaumitteilungen für Gebäude, die in vielen anderen Ländern getrost hätten stehen bleiben dürfen.
Gerade im Sinne der Nachhaltigkeit wollen wir diese Praxis hinterfragen: Betrachtet man nämlich den Primärenergieeinsatz über den gesamten Lebenszyklus, so ist eine Sanierung bei den meisten Bauten aus ökologischer Sicht sinnvoller als ein Ersatzneubau. Könnte nicht mit etwas Wagemut mehr aus unserer bestehenden Welt entwickelt werden – ohne dabei das Bestehende und dessen verbaute Energie zu verlieren?
Im Homeoffice lockt die Stadt mit Spaziergängen im Quartier. Ernüchtert betrachten wir dabei die neuen Wohnklumpen, machen kehrt und gehen zurück in unsere befristeten Wohnungen. Dicht an dicht begleiten wir unser Zuhause zu seinem Lebenshorizont – hoffnungsvoll, dass an diesem in Zukunft weitergebaut wird.
* Jakob Junghanss, Lukas Ryffel und Oliver Xaver Burch befassen sich in ihrer Masterarbeit in Architektur an der ETH Zürich mit dem Gebäudebestand der Zürcher Nachkriegsmoderne.