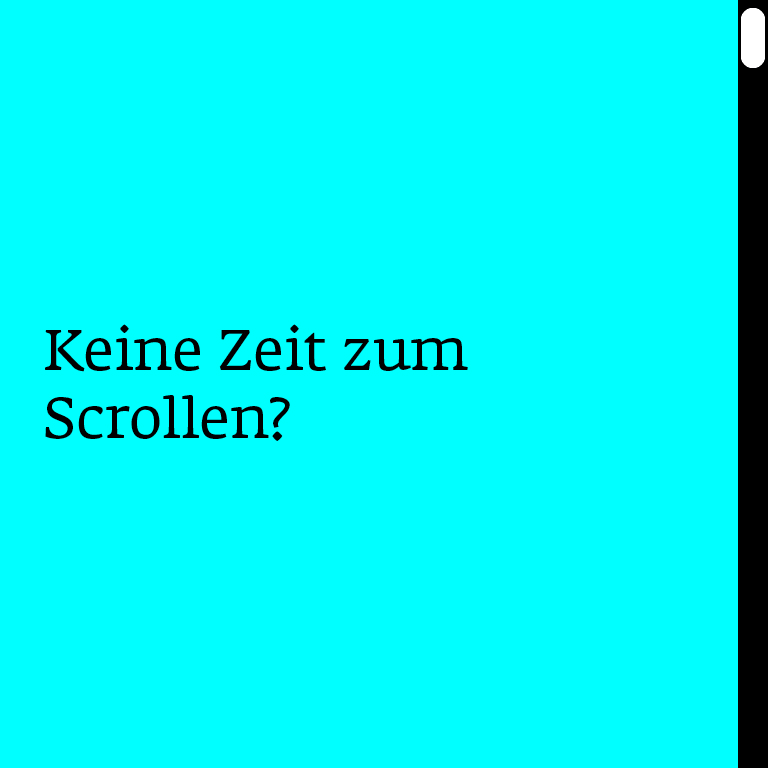Schöne neue Stadt
Die Agglomeration soll urban werden. Aktuelle Wettbewerbe stärken die Tendenz zur ‹städtischen Fassade›. Mit einem normierten Bild von Stadt ist der Agglomeration aber nicht geholfen.
Trotz des namensgebenden Touristenmagneten ist Neuhausen am Rheinfall eine typische und etwas verschlafene Agglomerationsgemeinde. Die Melange aus Handwerkerhäusern, Fünfzigerjahreblocks und Wohnhochhäusern, aus Industriearealen und Fabrikantenvillen, aus Einkaufszentren, Schweizerfahnen und Pizzabuden ergibt in Kombination mit dem Naturschauspiel des Rheinfalls ein Sittenbild helvetischer Eigentümlichkeit, wie es schöner fast nicht zu finden ist. Die Zeit scheint ein wenig stehen geblieben zu sein: Ja, so ungefähr sah Ende des 20. Jahrhunderts das Mittelland abseits der grösseren Städte aus.
Aber das Dorf, das schon lange kein Dorf mehr ist, steht vor einschneidenden Veränderungen. Neben dem Industrieplatz, dem Rhytech- und dem SIG-Areal soll auch das Ortszentrum von Neuhausen neu überbaut werden. Den Studienauftrag haben Caruso St John Architects im letzten Jahr gewonnen. Adam Caruso möchte anstelle des bestehenden «Flickwerks», in dem die öffentlichen Gebäude «architektonisch und städtebaulich bezugslos» nebeneinanderstünden, ein urbanes Zentrum schaffen (siehe hochparterre.wettbewerbe 3 / 15). Ein Grossteil des Bestands wird zu diesem Zweck abgerissen und durch Neubauten mit axialsymmetrischen Fassaden ersetzt. Den neuen, rechteckigen Platz in der Mitte nennt Caruso ‹Agora›, die Arkade, die den grössten Baukörper über die ganze Länge begleitet, ‹Stoa›. Die tektonisch gegliederten Fassaden schliesslich knüpfen für ihn an «eine Architektur mit langer Tradition» an. Für sich genommen ist dies zweifellos ein sorgfältiger, stimmiger Entwurf. Nur hat er mit Neuhausen in etwa so viel gemein wie der ‹Plan Voisin› Le Corbusiers mit dem historischen Paris.
Das Projekt ist ein Beispiel unter vielen: Je länger, je mehr zeigt sich, dass die bauliche Entwicklung der Agglomeration einhergeht mit einem bestimmten Bild von ‹städtischer Architektur›. Warum ist das so? Und ist das gut?
Silberstreifen am Horizont
Seit vergangenem Sommer ist wissenschaftlich beglaubigt, was Architekturschulen und Fachverbände im Chor mit dem gehobenen Feuilleton schon länger predigen. ‹Neue urbane Qualität› tut dem Land not. Jürg Sulzer, Leiter eines Nationalen Forschungsprojekts mit ebendiesem Titel, verkürzte die vielfältigen Erkenntnisse verschiedener Forschungsgruppen auf eine einfache Forderung: die ‹Stadtwerdung der Agglomeration› (siehe Hochparterre 8 / 15). Die Rollen sind verteilt: Als beklagenswerter Ist-Zustand tritt die Agglomeration auf, die Sulzer anonym und gesichtslos nennt, als Zukunftsbild leuchtet die identitätsstiftende Stadt, die ein grosses Wort für sich beanspruchen darf: Schönheit. Zu verlieren gibt es dabei nichts, da die Siedlungen aus dem 20. Jahrhundert, so der Befund, «in der Regel alles andere als erhaltenswert» seien. Als «Silberstreifen am Horizont» erscheinen sodann zwei neue Stadtquartiere in der Zürcher Peripherie: das Richti-Areal in Wallisellen und das Limmatfeld in Dietikon. Sie würden Anlass geben, mutig voranzugehen, schreibt Sulzer, denn hier zeige sich, «wie wir Stadtbauarchitektur in Zukunft verstehen sollen». – Ja, wie eigentlich? Die klingende Wortschöpfung ‹Stadtbauarchitektur› verrät bereits den umfassenden Anspruch: Sulzer und Kollegen geht es nicht nur um die Möglichkeiten baulicher Verdichtung, nein, die ‹Stadtwerdung der Agglomeration› will auch architektonisches Programm sein.
Nun braucht es nicht viel Fantasie, um zu erraten, wie diese Architektur auszusehen hat: «Ein Haus», erklärte Jürg Sulzer dem interessierten Laien in der NZZ, «hat einen klar lesbaren Bezug zum öffentlichen Strassenraum, eine klar gestaltete Sockelzone mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten und einen betonten Dachabschluss.» Weiter lesen wir von ‹Fassadengliederung›, von der ‹Durchformung der Aussenwände› und von ‹Vor- und Rücksprüngen mit ihren Schattenwirkungen›. Pate standen offenkundig Hans Kollhoffs ‹Baukunst des Schattens› und die von Vittorio Magnago Lampugnani immer wieder beschworene ‹Normalität› im Städtebau. Und damit schliesst sich der Kreis in einmütiger Harmonie, denn die ‹Silberstreifen am Horizont› stammen aus der Feder just dieser beiden Vordenker: Kollhoff plante das Limmatfeld, Lampugnani das Richti-Areal. Beide Architekten entwarfen zudem je ein exemplarisches städtisches Gebäude. Mit Eckerkern, Gesimsen und Giebeln erinnert Kollhoffs Haus dabei an die Berliner Gründerzeit, während Lampugnanis Hofrandbebauung mit der lang gezogenen Arkade und den stehenden Fenstern italienische Vorbilder ins Gemüt ruft.
Bilder bauen Städte
Dass es ein Gebot der Vernunft ist, mehr haushälterische Bodennutzung und mehr Dichte, auch mehr baulichen Gemeinsinn, kurz: eben mehr Stadt zu fordern, steht ausser Frage. Eine kritische Diskussion über die konkrete Architektur dieser neuen Stadt hingegen wäre angebracht. «Die zentrale Bestimmung der Disziplin Städtebau», sagt Lampugnani dazu, muss «die Deutung und Definition der gebauten Form der Stadt» sein. Man möchte nicht widersprechen. Wie überhaupt vieles, was die Fürsprecher einer neuen urbanen Qualität als Argumente ins Feld führen, dem gesunden Menschenverstand zu schmeicheln weiss: Sollten denn Häuser, wie Kollhoff fragt, nicht so beschaffen sein, dass daraus «ein grosses Ganzes, eine Stadt» erwachsen kann? Sicherlich, das wäre wünschenswert. Ist der bescheidene Hausbau nicht den ‹PR-Spektakeln› der Star-Architekten vorzuziehen? Bestimmt. Und wer hat schon ernsthaft etwas gegen ‹identitätsstiftende Stadträume› und ‹erkennbare Ortsbilder› einzuwenden, wie sie Jürg Sulzer fordert? Niemand. Dass die dichte Stadt als ‹Zivilisationsmaschine par excellence› auch von immensem kulturellen, sozialen und integrativen Wert ist, wie Lampugnani feststellt, wird schliesslich jeder aufgeklärte Zeitgenosse gerne unterschreiben. Tatsächlich beginnt Urbanität dort, wo unterschiedliche Lebensformen und Ideen nebeneinander existieren und sich über alle Widersprüche hinweg gegenseitig zu befruchten vermögen.
Nun ist es aber gerade diese Akzeptanz eines anderen, an der es den Visionen von einer ‹Neuen urbanen Qualität› schmerzhaft mangelt. Denn die Bilder, die Sulzer und seine Gewährsleute in Wort und Bau erstehen lassen, sind ausnahmslos Bilder einer historischen Stadt, einer historischen Architektur und damit – weil Architektur von Repräsentation nun einmal nicht zu trennen ist – auch Sinnbilder einer bestimmten Vorstellung bürgerlichen Lebens. Und langsam aber sicher haben diese Bilder begonnen, ihren Dienst in der täglichen Architekturproduktion zu tun. Es ist kein Grund zur Freude. Denn was sich in der Theorie differenziert anhört, äusserst sich in der Wirklichkeit der Bauwirtschaft als merkwürdige Verkümmerung des architektonischen Vokabulars. Vom Reichtum der Lösungen, den die Stadtbaugeschichte fraglos bieten würde, bleibt die Variation des immer gleichen Typus übrig. ‹Stadtwerdung der Agglomeration›? Ihre Realität ist die massive Rasterfassade mit einer Arkade im Erdgeschoss, ihr Farbton die falsche Patina des Beigen und Bronzenen, ihre Dekoration die profilierte Aussenhaut und die historisierenden Pendelleuchten.
Tabula rasa
Die Beschwörung der intakten bürgerlichen Stadt geht einher mit einer tief sitzenden Abneigung gegen die Moderne: Dem Städtebau der Moderne wird schlechterdings alles angelastet, was in den letzten Jahrzehnten zur formlosen Erscheinung der Agglomeration beigetragen hat. Man darf diese Entwicklung mit Recht beklagen. Man muss auch zwingend nach konkreten Lösungen suchen, wie die Agglomeration baulich und sozial verdichtet werden kann. Aber man sollte dies mit einer gewissen Liebe zum Bestehenden tun. Was eine Sulzer’sche Stadtbauarchitektur nicht vermag, ja, was sie in ihrem Furor gegen die «fehlgeleitete städtebauliche Ideologie der Moderne» gar nicht will, ist ein Dialog mit der real existierenden Peripherie, diesem bunten Nebeneinander von Überlandstrassen, Siedlungen und idyllischen Naturräumen, von Dorfzentren, Gewerbezonen und Shoppingmalls. Es ist die blosse Antithese: dort die wildgewachsene Agglomeration, hier die normierte schöne Stadt. Daher der seltsam insulare Charakter der neuen Stadtquartiere. Er lässt sie noch künstlicher erscheinen, als sie aufgrund ihrer zeitgereisten Fassaden ohnehin sind.
Im Extremfall führt diese Haltung zur Tabula rasa mitten im Ortszentrum, wie sie beim Projekt von Caruso St John in Neuhausen zu beobachten ist. Die aufgesetzte Urbanität beisst sich hier selbst in den Schwanz: Was sie rhetorisch behauptet – eben die produktive Vielfalt der Dichte, die Reibung am anderen –, verneint sie gleichzeitig mit ihrer hermetischen architektonischen Sprache. An die Stelle eines aufmerksamen Blicks für die Qualitäten des Vorhandenen, an die Stelle einer zeitgenössischen Architektur, die das Bestehende stärken und unter neuen Perspektiven erlebbar machen würde, ist ein selbstgenügsamer Städtebau getreten, der die Deutungshoheit darüber, was gut und städtisch ist, für sich allein beansprucht.
Der Zwang zum städtischen Kleid
Mittlerweile lässt der verinnerlichte anti-modernistische Reflex alles verdächtig unstädtisch erscheinen, was sich nicht in das hoheitliche Gewand der schweren Pfeiler, französischen Fenster und massiven Mauerblenden kleidet. Typisch für dieses Phänomen sind zwei Wettbewerbe für das Geistlich-Areal in Schlieren, die letzten Sommer gleichzeitig juriert wurden. Auf dem Baufeld mit dem Kürzel B 2.1 gewannen Gmür Geschwentner Architekten mit einem auf subtile Weise erfindungsreichen Wohnbauprojekt. Hervor sticht insbesondere die Erschliessung der Wohnungen über erdgeschossige Galerien, die zwei begrünte Höfe umschliessen. Filigrane innenliegende Stützen und eine durchgehende Verglasung variieren hier das moderne Thema der Durchdringung von Innen- und Aussenraum, während Materialisierung und Deckengestaltung aus der Ferne den frohgemuten Klang südamerikanischer Architektur herantragen. Auch das ist natürlich ein Bild – doch immerhin ein heiteres. Einen merkwürdigen Paradigmenwechsel zeigt dann die äussere Erscheinung: Als hätten sich die Architekten nicht in die Nesseln setzen wollen, folgen sie da dem Ruf zum ‹städtischen Kleid›: Es darf auf keinen Fall zu leicht wirken.
Ähnliches zeigt das prämierte Projekt von Graber Pulver Architekten auf Baufeld B 2.2 / C1, das den Auftakt zum neuen Stadtquartier bilden wird. Während innen das corbusianische Motiv par excellence, die ‹rue intérieure›, treffend aktualisiert und auf die zeitgenössische Form kollektiven Wohnens angewandt wird, stellen die Fassaden eine weitere Variation der bekannten Mischung aus klassizistischen und rationalistischen Anleihen dar.
Ortsfremde Gleichform
Bleibt anzumerken, dass bei den kommerziellen Mitläufern und Investoren von diesen mitunter vielschichtigen ‹städtischen Fassaden› nichts anderes mehr übrig bleibt als der banale Raster – die schlechtesten Beispiele modernistischer Bauspekulation liegen nicht mehr fern.
Nun sind der Historismus dieser Stadtbauarchitektur, ihr neo-bürgerlicher Habitus und ihre autokratische Tendenz das eine. Das andere ist die daraus folgende Uniformität. Ging es Jürg Sulzer nicht um ‹erinnerungsfähige Lebensumfelder› und ‹identitätsbildende Stadträume›? Ob man will oder nicht: Auch die Agglomerationen des 20. Jahrhunderts besitzen einen Erinnerungswert, den es ernst zu nehmen gilt – weil zwei Drittel der Bevölkerung dort aufgewachsen sind, und weil dieser so vage wie vielfältige Raum der Schauplatz ihres Lebens und ihrer Erinnerungen ist. Mit einem Städtebau, der als einzige Referenz eine ortsfremde Vergangenheit akzeptiert, ist eine Stärkung lokaler und zeitgenössischer Identität unmöglich. Er bewirkt das Gegenteil: Eingeschlossen im immer gleichen Kanon vorgeblich städtischer Architektur, weiss man bald nicht mehr, ob man sich gerade in Schlieren oder Bümpliz, in Neuhausen oder Lenzburg, in Wallisellen oder Geroldswil befindet. Unter einer ‹Stadtwerdung der Agglomeration› würde man sich gerne etwas anderes vorstellen.
Dieser Beitrag stammt aus der Ausgabe 1-2/2016 der Zeitschrift Hochparterre.